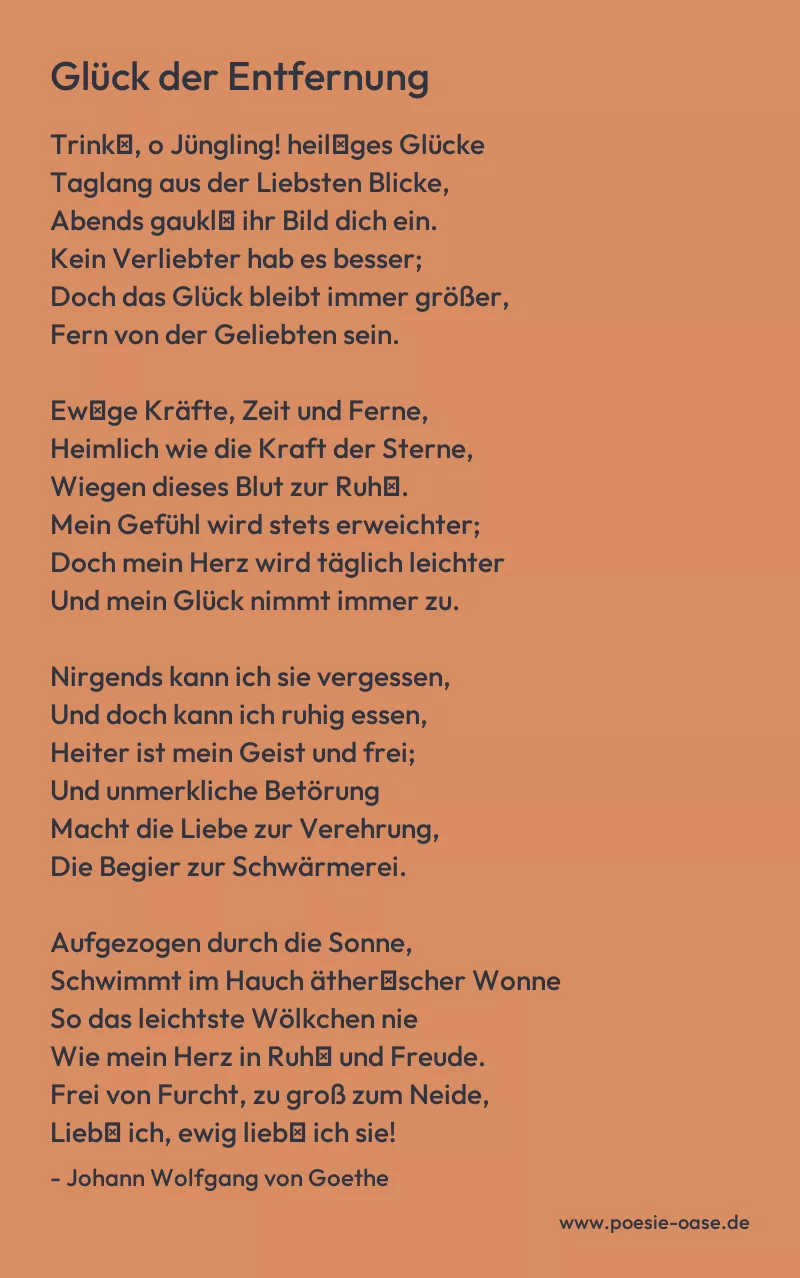Abenteuer & Reisen, Alltag, Angst, Emotionen & Gefühle, Feiertage, Freude, Gedanken, Götter, Helden & Prinzessinnen, Heldenmut, Leichtigkeit, Sommer, Universum
Glück der Entfernung
Trink′, o Jüngling! heil′ges Glücke
Taglang aus der Liebsten Blicke,
Abends gaukl′ ihr Bild dich ein.
Kein Verliebter hab es besser;
Doch das Glück bleibt immer größer,
Fern von der Geliebten sein.
Ew′ge Kräfte, Zeit und Ferne,
Heimlich wie die Kraft der Sterne,
Wiegen dieses Blut zur Ruh′.
Mein Gefühl wird stets erweichter;
Doch mein Herz wird täglich leichter
Und mein Glück nimmt immer zu.
Nirgends kann ich sie vergessen,
Und doch kann ich ruhig essen,
Heiter ist mein Geist und frei;
Und unmerkliche Betörung
Macht die Liebe zur Verehrung,
Die Begier zur Schwärmerei.
Aufgezogen durch die Sonne,
Schwimmt im Hauch äther′scher Wonne
So das leichtste Wölkchen nie
Wie mein Herz in Ruh′ und Freude.
Frei von Furcht, zu groß zum Neide,
Lieb′ ich, ewig lieb′ ich sie!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
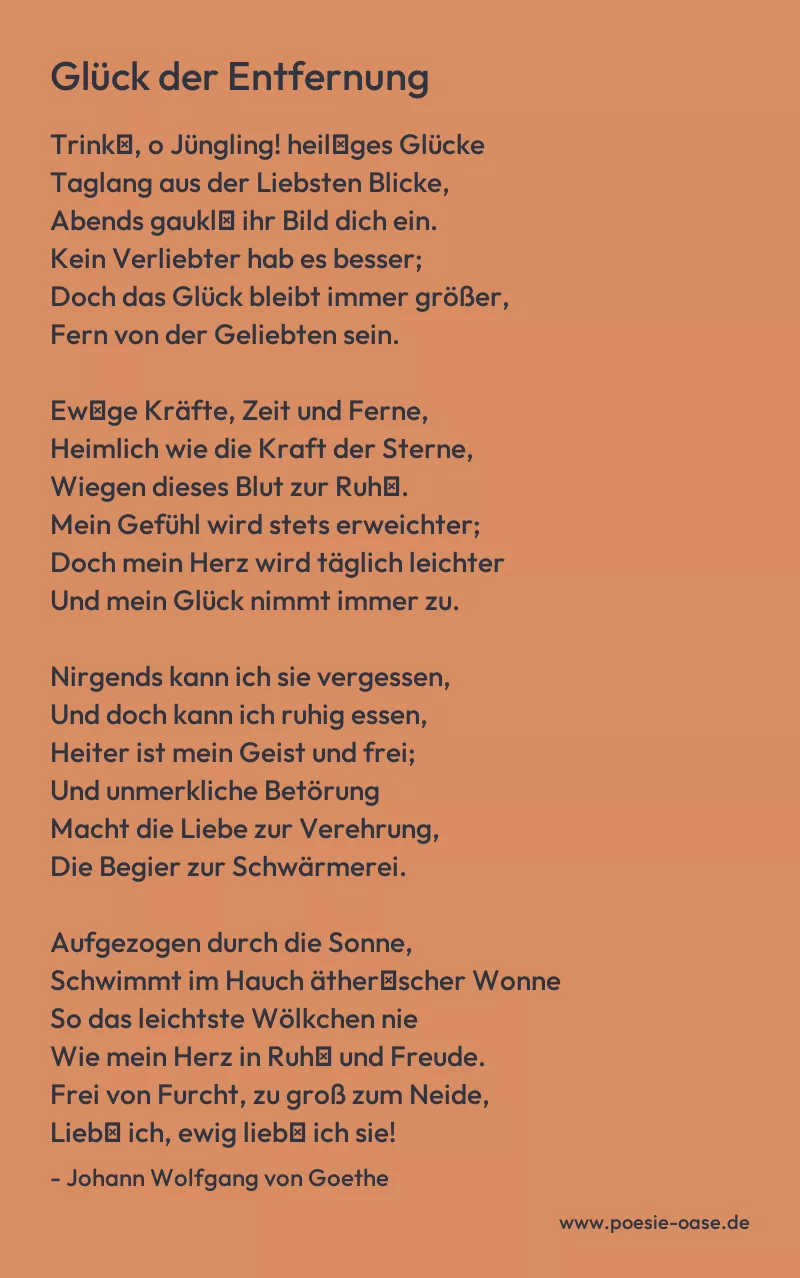
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Glück der Entfernung“ von Johann Wolfgang von Goethe thematisiert die transformative Kraft der Distanz in einer Liebesbeziehung. Es ist ein Loblied auf das Fernsein, das entgegen der landläufigen Vorstellung von Sehnsucht und Schmerz, als Quelle von Glück und innerer Freiheit dargestellt wird. Goethe wendet sich hier von dem unmittelbaren, leidenschaftlichen Erleben der Liebe ab und wählt stattdessen eine Betrachtungsweise, die auf der Erfahrung von Entfernung und Abwesenheit basiert.
Die erste Strophe beschreibt zunächst das Glück, das ein junger Liebender im direkten Kontakt mit der Geliebten erfährt. Doch bereits hier deutet Goethe an, dass das wahre Glück größer ist, wenn man von der Geliebten getrennt ist. Die zweite Strophe entfaltet diese Idee weiter, indem sie die „ew’gen Kräfte, Zeit und Ferne“ als Faktoren identifiziert, die das „Blut zur Ruh’“ wiegen. Das bedeutet, dass die Distanz dazu beiträgt, die Intensität der Leidenschaft zu mildern und das Gefühl zu verfeinern. Das Herz wird „täglich leichter“ und das Glück nimmt beständig zu. Dies ist eine interessante Umkehrung der traditionellen Vorstellung von Liebe, die oft mit Schmerz und Sehnsucht verbunden ist.
In der dritten Strophe wird die praktische Auswirkung der Entfernung beschrieben. Das Vergessen der Geliebten wird negiert; stattdessen entsteht eine innere Ruhe und Freiheit, die es ermöglicht, den Alltag unbeschwert zu gestalten. Die Liebe wandelt sich durch die Distanz von bloßer „Begier“ zur „Verehrung“ und „Schwärmerei“. Diese Transformation deutet auf eine Vergeistigung und Verklärung der Liebe hin, die durch die Abwesenheit der Geliebten begünstigt wird. Das Fehlen des direkten Kontakts schafft Raum für eine idealisierte Vorstellung der Geliebten und der Beziehung.
Die letzte Strophe ist ein Höhepunkt der Freude und der inneren Freiheit. Das Herz des Sprechers wird mit einem „leichtesten Wölkchen“ verglichen, das in den „Hauch äther’scher Wonne“ eintaucht. Die Freiheit von „Furcht“ und „Neide“ unterstreicht die positive Transformation, die die Entfernung bewirkt hat. Die Liebe wird zur ewigen Liebe, die von einer tiefen, unerschütterlichen inneren Ruhe getragen wird. Goethes Gedicht preist somit die transformative Kraft der Distanz, die die Leidenschaft in Verehrung und Freiheit verwandelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.