Euch, o Grazien, legt die wenigen Blätter ein Dichter
Auf den reinen Altar, Knospen der Rose dazu,
Und er tut es getrost. Der Künstler freuet sich seiner
Werkstatt, wenn sie um ihn immer ein Pantheon scheint.
Jupiter senket die göttliche Stirn, und Juno erhebt sie;
Phöbus schreitet hervor, schüttelt das lockige Haupt;
Trocken schauet Minerva herab, und Hermes, der leichte,
Wendet zur Seite den Blick, schalkisch und zärtlich zugleich.
Aber nach Bacchus, dem weichen, dem träumenden, hebet Cythere
Blicke der süßen Begier, selbst in dem Marmor noch feucht.
Seiner Umarmung gedenket sie gern und scheinet zu fragen:
»Sollte der herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehn?«
Euch, o Grazien…
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
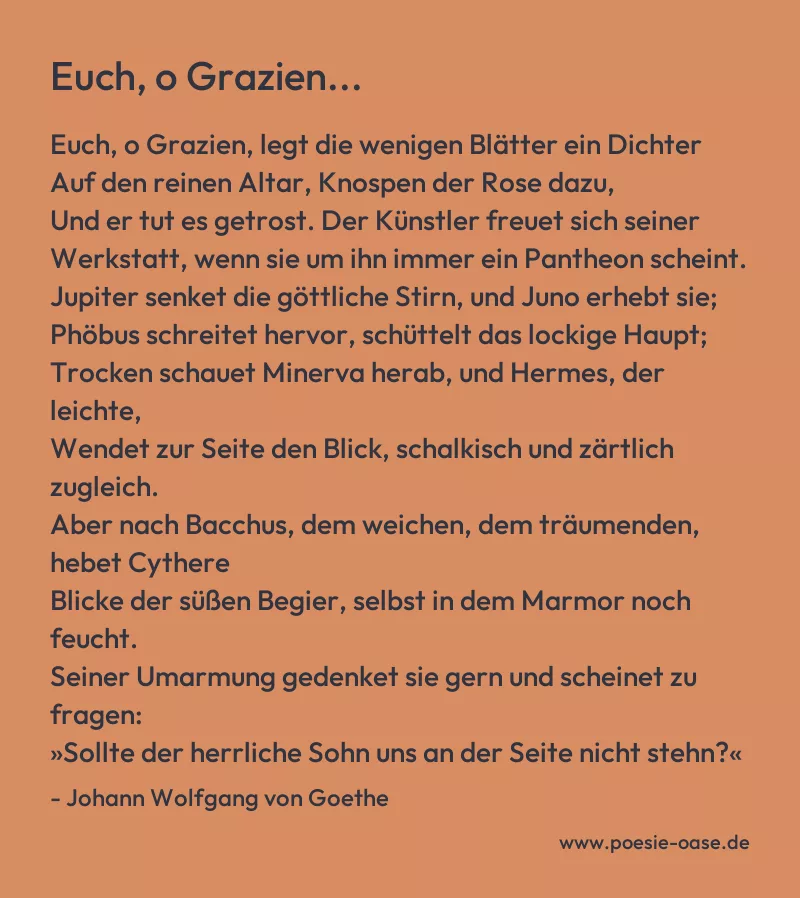
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Euch, o Grazien…“ von Johann Wolfgang von Goethe feiert die Schönheit und die künstlerische Schöpfung, indem es eine Szene in einem imaginären Pantheon entwirft. Das Gedicht beginnt mit der Opfergabe eines Dichters an die Grazien, die als Verkörperung von Anmut und Schönheit fungieren. Die Gabe, bestehend aus Blättern und Rosenknospen, symbolisiert die bescheidene, aber aufrichtige Verehrung des Dichters, der seine Arbeit in der Werkstatt als ein „Pantheon“ betrachtet, also als einen heiligen Ort, der von Göttern bewohnt wird.
Der Großteil des Gedichts beschreibt die Reaktion der verschiedenen Götter auf die Darbietung des Dichters. Jupiter, Juno, Phöbus, Minerva und Hermes werden erwähnt, wobei ihre charakteristischen Eigenschaften in kurzen, prägnanten Beschreibungen herausgestellt werden. Während einige Götter, wie Minerva, eher distanziert wirken, zeigen andere, wie Hermes, eine gewisse Neugier und Zuneigung. Die Beschreibung der Götter deutet auf eine Vielfalt von menschlichen Eigenschaften hin, die im Pantheon vereint sind, und verstärkt somit die Vorstellung von der künstlerischen Schöpfung als einem Spiegelbild des Lebens.
Die stärkste Emotion wird durch die Erwähnung von Bacchus und Cythere, also Venus, ausgelöst. Venus, von sehnsüchtiger Begierde erfüllt, erinnert sich an die Umarmung des Bacchus und scheint dessen Anwesenheit zu wünschen. Diese Szene der Sehnsucht und Begierde, festgehalten in den „feuchten“ Marmor, der die Skulpturen veranschaulicht, unterstreicht die Bedeutung von Liebe und Sinnlichkeit im Kunstwerk. Die Frage, ob der „herrliche Sohn“ (vermutlich Amor) an ihrer Seite stehen sollte, fügt einen weiteren Aspekt der familiären und emotionalen Dynamik in das Bild ein.
Goethes Gedicht ist somit nicht nur eine Ode an die Kunst, sondern auch eine Reflexion über die verschiedenen Aspekte menschlicher Erfahrung, von der Schönheit und Anmut bis hin zur Sehnsucht und Leidenschaft. Der Dichter scheint zu suggerieren, dass die Kunst ein Spiegelbild der Welt ist, in dem sowohl das Göttliche als auch das Menschliche auf subtile Weise verschmelzen. Die Wahl des Pantheons als Schauplatz betont die Ehrfurcht des Dichters vor der Kunst und seinen Glauben an ihre Fähigkeit, das Leben in all seinen Facetten zu erfassen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
