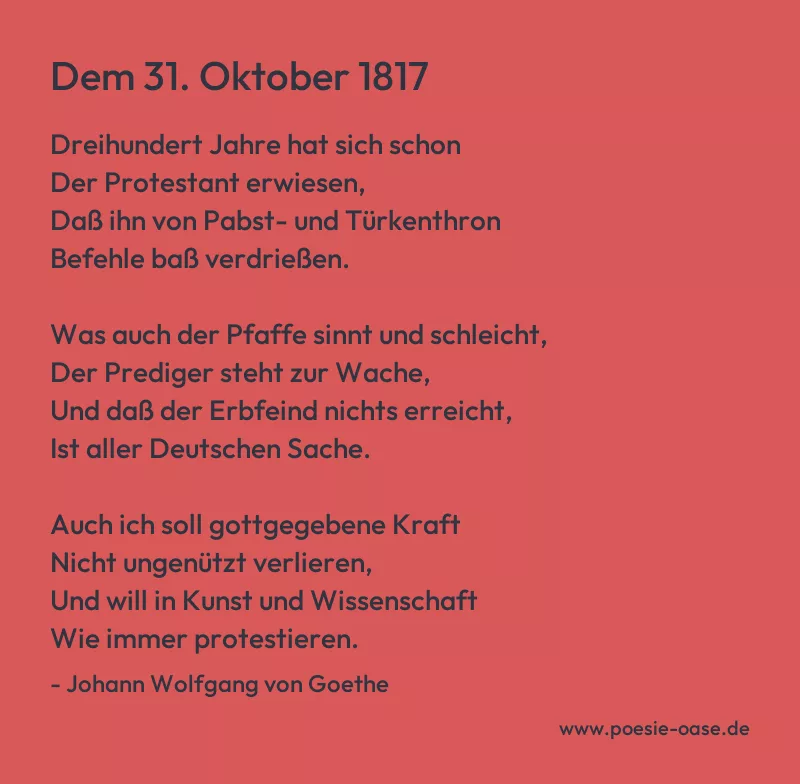Dem 31. Oktober 1817
Dreihundert Jahre hat sich schon
Der Protestant erwiesen,
Daß ihn von Pabst- und Türkenthron
Befehle baß verdrießen.
Was auch der Pfaffe sinnt und schleicht,
Der Prediger steht zur Wache,
Und daß der Erbfeind nichts erreicht,
Ist aller Deutschen Sache.
Auch ich soll gottgegebene Kraft
Nicht ungenützt verlieren,
Und will in Kunst und Wissenschaft
Wie immer protestieren.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
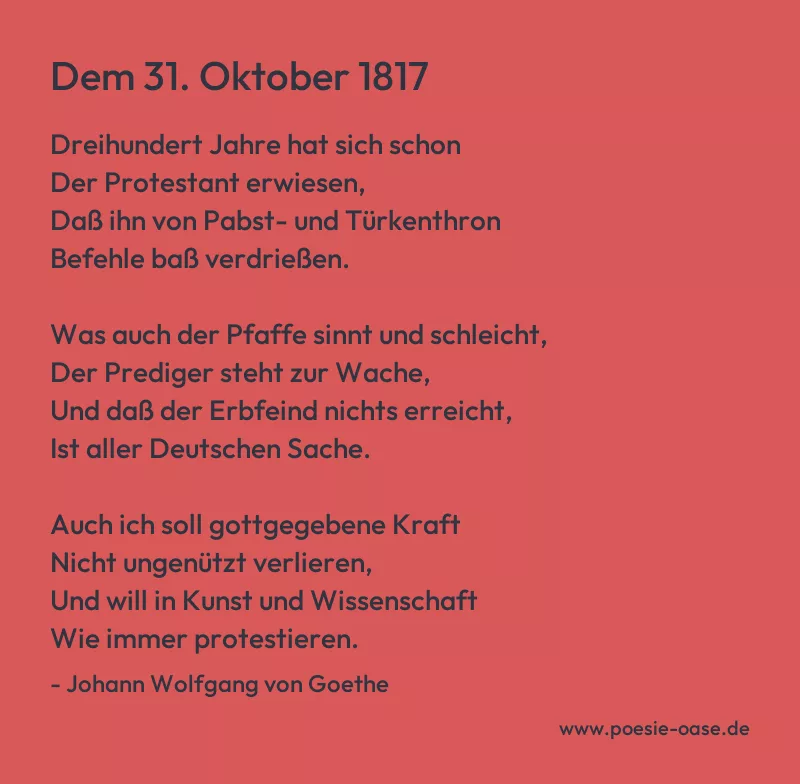
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Dem 31. Oktober 1817“ von Johann Wolfgang von Goethe feiert den Jahrestag der Reformation und die protestantische Tradition. Es ist ein Bekenntnis Goethes zur Freiheit des Geistes und zur Unabhängigkeit von religiöser und politischer Bevormundung. Die Strophen sind klar strukturiert und transportieren eine Botschaft des Widerstands und der Eigenständigkeit. Der Titel selbst, der das Datum der Reformation nennt, markiert den Anlass und den thematischen Schwerpunkt des Gedichts.
Goethe beginnt mit der Feststellung, dass die Protestanten seit dreihundert Jahren Widerstand gegen die Macht des Papstes und des Osmanischen Reiches leisten. Dies deutet auf eine Tradition des Kampfes für Freiheit und Selbstbestimmung hin. Die Erwähnung von „Papst- und Türkenthron“ unterstreicht die Bedrohung, der sich die Protestanten ausgesetzt sahen, und die Bedeutung ihrer Standhaftigkeit. Die zweite Strophe konkretisiert dies weiter: Die Pfaffen werden als „sinnt und schleicht“ beschrieben, was ihre heimlichen Machenschaften und Intrigen impliziert. Die Prediger stehen dagegen „zur Wache“, und es ist die „aller Deutschen Sache“, den „Erbfeind“ (also die katholische Kirche und möglicherweise auch andere Feinde) zu bekämpfen.
Im dritten Teil des Gedichts wendet sich Goethe seiner eigenen Rolle zu. Er betrachtet seine künstlerische und wissenschaftliche Arbeit als eine Form des Protestes. Er will seine „gottgegebene Kraft“ nicht ungenutzt lassen und sich durch seine Schaffen gegen jede Form der Bevormundung zur Wehr setzen. Der Ausdruck „wie immer protestieren“ verdeutlicht, dass diese Haltung für Goethe eine ständige Lebensaufgabe darstellt. Er betrachtet Kunst und Wissenschaft als Mittel, um die Freiheit des Denkens und der Ausdrucksweise zu verteidigen.
Insgesamt ist das Gedicht ein starkes Plädoyer für Freiheit, Eigenständigkeit und die aktive Auseinandersetzung mit religiösen und politischen Machtstrukturen. Goethe feiert die Reformation nicht nur als historisches Ereignis, sondern auch als einen fortwährenden Kampf für geistige Freiheit und Selbstverwirklichung. Das Gedicht zeugt von Goethes tiefer Überzeugung, dass der Mensch durch seine Kunst und Wissenschaft einen Beitrag zur Verteidigung der Freiheit leisten muss.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.