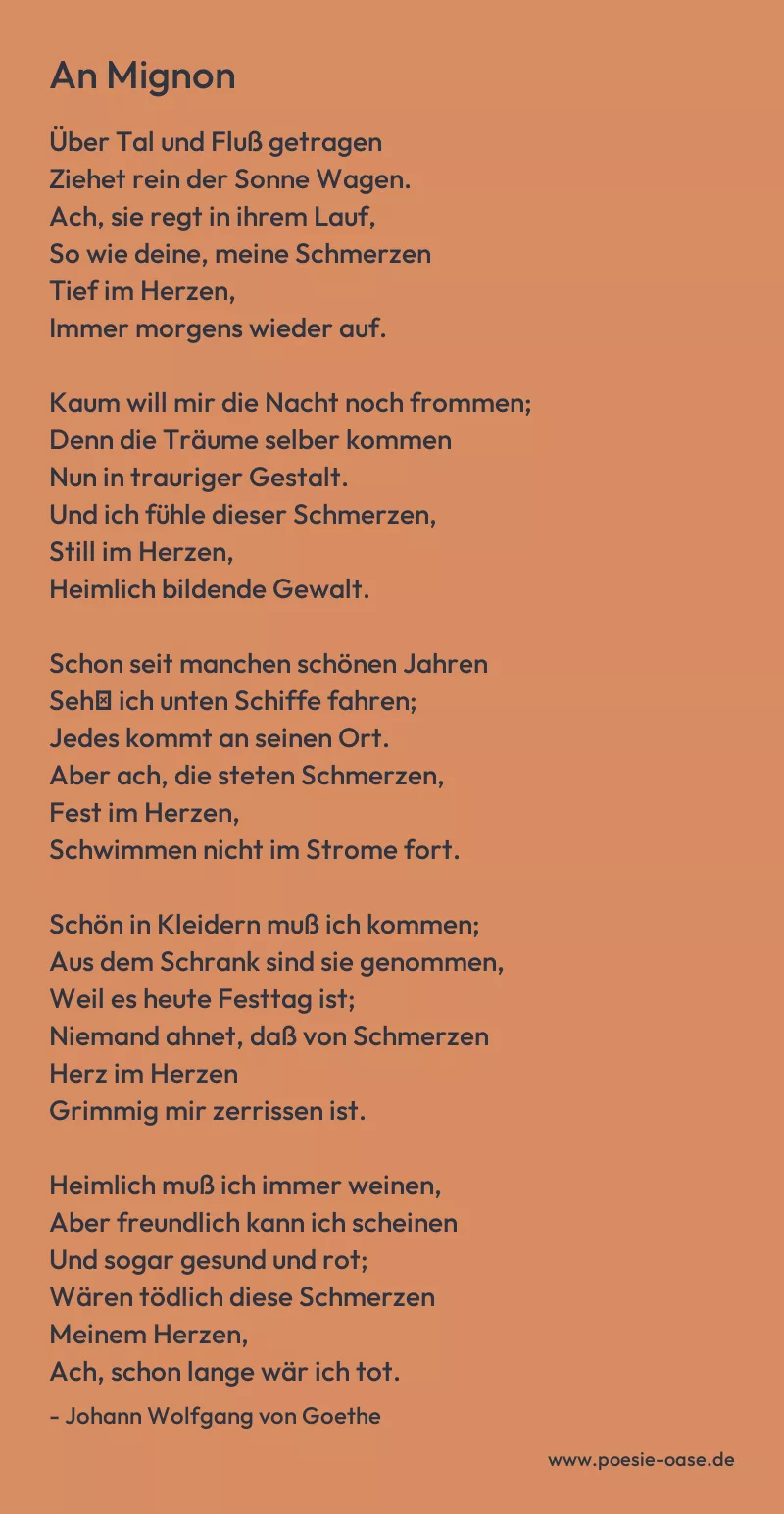An Mignon
Über Tal und Fluß getragen
Ziehet rein der Sonne Wagen.
Ach, sie regt in ihrem Lauf,
So wie deine, meine Schmerzen
Tief im Herzen,
Immer morgens wieder auf.
Kaum will mir die Nacht noch frommen;
Denn die Träume selber kommen
Nun in trauriger Gestalt.
Und ich fühle dieser Schmerzen,
Still im Herzen,
Heimlich bildende Gewalt.
Schon seit manchen schönen Jahren
Seh′ ich unten Schiffe fahren;
Jedes kommt an seinen Ort.
Aber ach, die steten Schmerzen,
Fest im Herzen,
Schwimmen nicht im Strome fort.
Schön in Kleidern muß ich kommen;
Aus dem Schrank sind sie genommen,
Weil es heute Festtag ist;
Niemand ahnet, daß von Schmerzen
Herz im Herzen
Grimmig mir zerrissen ist.
Heimlich muß ich immer weinen,
Aber freundlich kann ich scheinen
Und sogar gesund und rot;
Wären tödlich diese Schmerzen
Meinem Herzen,
Ach, schon lange wär ich tot.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
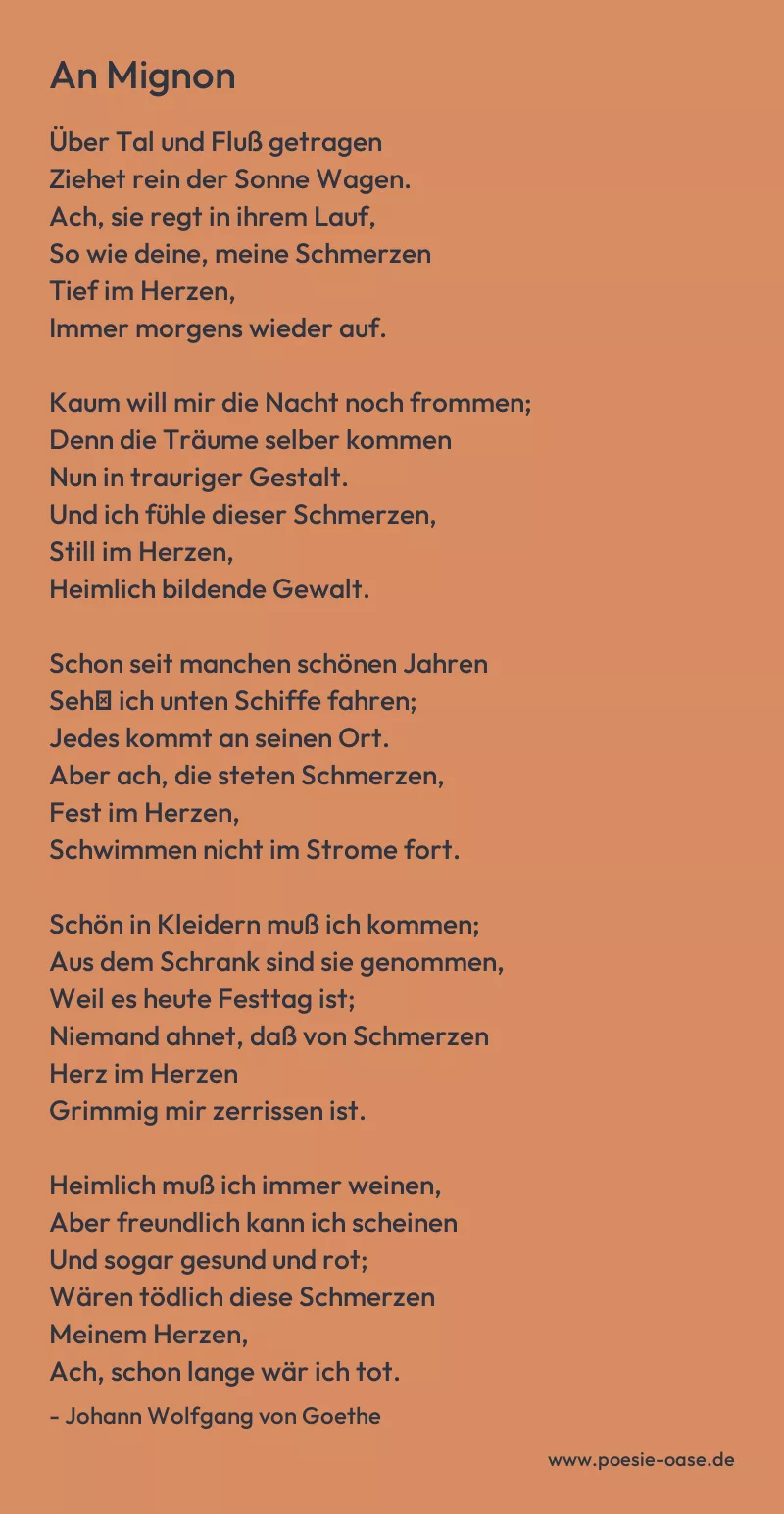
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Mignon“ von Johann Wolfgang von Goethe ist ein ergreifender Ausdruck tiefen Leids und innerer Zerrissenheit, der sich durch die Metapher der Mignon, einer fiktiven Figur aus Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, manifestiert. Das Gedicht zeichnet das Porträt einer Person, die ihre Trauer und ihren Schmerz unter einer Fassade der Freundlichkeit und des äußeren Scheins verbirgt. Die Verwendung von Bildern wie der Sonne, den Flüssen und den Schiffen, die die Bewegung und den Lauf der Zeit darstellen, steht im Kontrast zu dem Stillstand und der Unveränderlichkeit des inneren Leids der lyrischen Ich-Person.
Das Gedicht ist in vier Strophen unterteilt, wobei jede Strophe eine Facette des inneren Konflikts beleuchtet. Die erste Strophe beschreibt das Wiederaufflammen des Schmerzes mit dem Morgengrauen, ein Bild, das die Konstanz und das Wiederkehren des Leids unterstreicht. Die zweite Strophe vertieft die Thematik durch die Erwähnung von Träumen, die in „trauriger Gestalt“ erscheinen, was auf eine tiefe, seelische Qual hinweist, die selbst im Schlaf keine Ruhe findet. Die dritte Strophe verstärkt die Unfähigkeit des lyrischen Ichs, dem Schmerz zu entkommen, indem sie die Vergänglichkeit der äußeren Welt, repräsentiert durch Schiffe, die an ihren Bestimmungsort gelangen, der Unfähigkeit, die eigenen „steten Schmerzen“ im Strom des Lebens zu überwinden, gegenüberstellt.
In der letzten Strophe erreicht die versteckte Tragödie ihren Höhepunkt. Das lyrische Ich ist gezwungen, eine Maske der Freude zu tragen, während es innerlich von Schmerzen zerrissen wird. Der Widerspruch zwischen dem äußeren Schein und dem inneren Leiden wird durch die Notwendigkeit, „schön in Kleidern“ zu erscheinen und „freundlich zu scheinen,“ verdeutlicht, während das Herz „grimmig zerrissen“ ist. Die abschließenden Zeilen, in denen der Wunsch nach dem Tod als Erlösung von den unerträglichen Schmerzen ausgedrückt wird, unterstreichen die Intensität des Leids und die Verzweiflung der Person.
Goethe verwendet einfache, aber kraftvolle Sprache, um eine tiefgehende emotionale Erfahrung zu vermitteln. Die Wiederholung von „Schmerzen“ und „im Herzen“ verstärkt die Zentriertheit des Leids und die Tiefe der emotionalen Verletzung. Die Alliterationen und der gleichmäßige Rhythmus des Gedichts verleihen ihm eine hypnotische Qualität, die den Hörer in die Gefühlswelt des lyrischen Ichs hineinzieht. Das Gedicht ist somit nicht nur eine Beschreibung von Trauer, sondern auch eine eindringliche Auseinandersetzung mit der menschlichen Fähigkeit, Schmerz zu verbergen und die äußere Welt zu täuschen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.