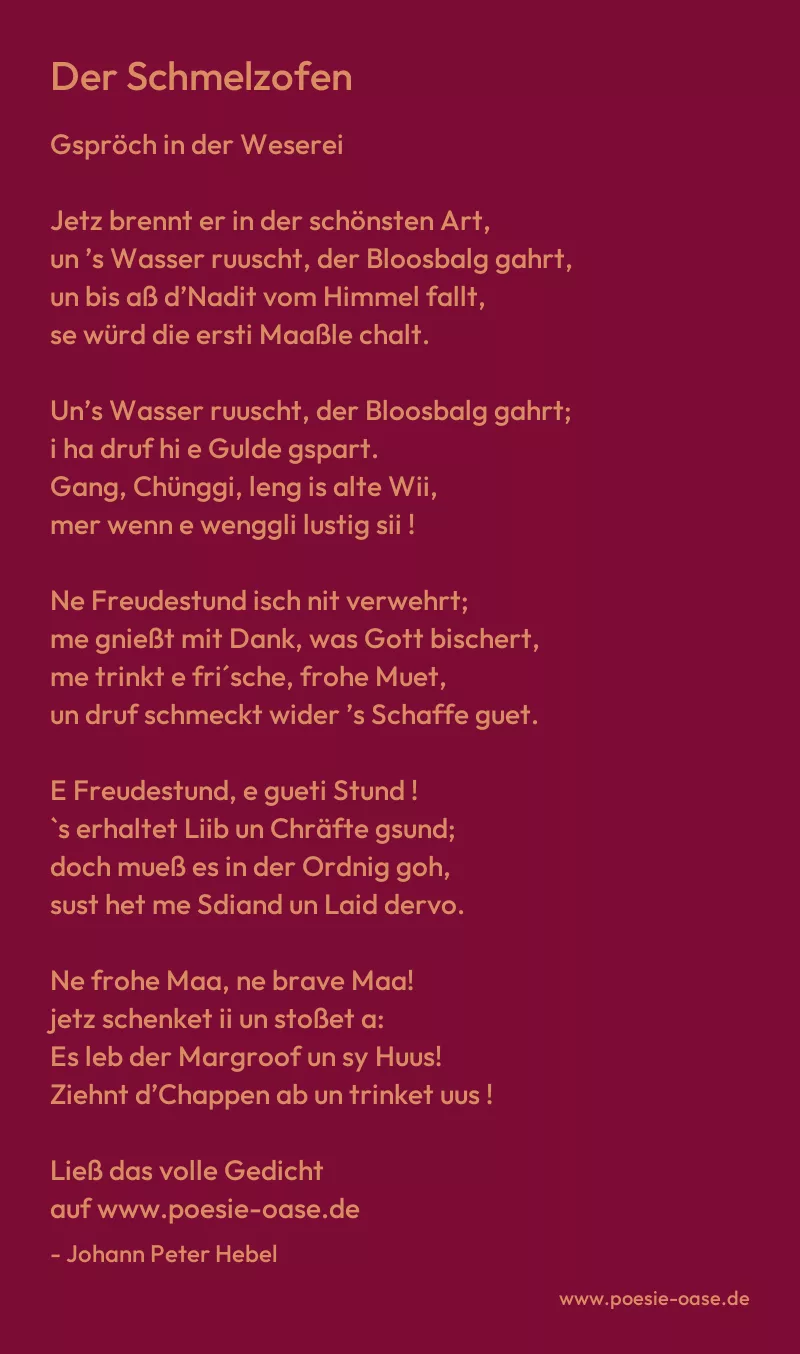Gspröch in der Weserei
Jetz brennt er in der schönsten Art,
un ’s Wasser ruuscht, der Bloosbalg gahrt,
un bis aß d’Nadit vom Himmel fallt,
se würd die ersti Maaßle chalt.
Un’s Wasser ruuscht, der Bloosbalg gahrt;
i ha druf hi e Gulde gspart.
Gang, Chünggi, leng is alte Wii,
mer wenn e wenggli lustig sii !
Ne Freudestund isch nit verwehrt;
me gnießt mit Dank, was Gott bischert,
me trinkt e fri´sche, frohe Muet,
un druf schmeckt wider ’s Schaffe guet.
E Freudestund, e gueti Stund !
`s erhaltet Liib un Chräfte gsund;
doch mueß es in der Ordnig goh,
sust het me Sdiand un Laid dervo.
Ne frohe Maa, ne brave Maa!
jetz schenket ii un stoßet a:
Es leb der Margroof un sy Huus!
Ziehnt d’Chappen ab un trinket uus !
E beßre Heer trait d’Erde nit!
`s isch Sege, was er tuet un gitt;
i cha’s nit sage, wie n i sott:
Vergelt’s ein Gott ! vergelt’s ein Gott!
Un ’s Bergwerch soll im Sege stoh!
`s het mengge Burger ’s Brot dervo.
Der Heer Inspekter lengt in Trog
un zahlt mit Freud, es isch ke Froog.
Drum schenket ii un stoßet a!
Der Heer Inspekter isch e Maa,
mit üüsers Gattigs Lüte gmai
un fründli gege groß un chlai.
Er schafft e guete Wii uf s Werk,
er holt en über Tal un Berg;
er stellt en Iuuter uf e Tisch
un mißt, wie’s recht un billig isch.
Sell isch verbei: der Maa am Füür
mueß z’trinke ha, wär’s no so tüür.
Es rislet mengge Tropfe Schwaiß;
un will’s nit goh, men ächzet ais.
Me straift der Schwaiß am Ärmel ab,
me schnuufet; d’Bälg verstuune drab,
un menggi liebi Mitternacht
wird so am haiße Herd verwacht.
Der Schmelzer isch e ploogte Maa,
drum bringet ein’s un stoßet a:
Gsegott!Vergiß dy Schwaiß un Ach !
`s het jeden andren au sy Sach.
Am Zahltag tailtisch doch mit kaim;
un bringsch der Lohn im Nastuech haim,
se luegt di d’Marei fründli a
un sait:“I ha ne brave Maa!“
Druf schlacht si Eier-en-Anken ii
un streut e wenig Imber drii;
si bringt Salat un Grüebe dra
un sait: „Jetz iß, du liebe Maa l“
Un wenn e Maa sy Arbet tuet,
se schmeckt em au sy Esse guet.
Er tuuschti nit in Laid un Lieb
mit menggem riiche Galgedieb.
Mer sitze do, un ’s schmeckt is wohl.
Gang, Chünggeli, leng is nonemool,
wil doch der Of e wider goht
un ’s Erz in volle Chübel stoht!
So brenn er denn zue gueter Stund,
un Gott erhalt ich alli gsund,
un Gott biwahr ich uf der Schicht,
aß niemes Laid un Unglück gschicht!
Un chunnt in strenger Winterszyt,
wenn Schnee uf Berg un Firste lyt,
en arme Bueb, en arme Maa
un steht ans Füür un wärmt si dra
un bringt e paar Grumbireli
un lait s’ ans Füür un brootet si
un schlooft bym Setzer uf em Erz –
schloof wohl, un tröst der Gott dy Herz!
Dört stoht so ain.Chumm, arme Maa,
un tue ais Bschaid! Mer stoßen a!
Gsegott, un tröst der Gott dy Herz!
Me schlooft nit lieblich uf ein Erz.
Un chunnt zuer Zyt e Bidermaa
ans Füür un zündet’s Pfiifli a,
un setzt si näumen ane mit,
se schmeck’s ein wohl, un – brenn di nit !
Doch fangt e Büebli z’rauchen a
un maint, es chönn’s as wie ne Maa,
se macht der Schmelzer churze Bridit
un zieht em’s Pfiifli uus cm Gsicht.
Er keit’s ins Füür un balgt derzue:
„Hesch’s au scho glehrt, du Lappi du!
Suug am e Störzli Habermark!
Waisch?Habermark macht d’Buebe stark !“
`s isch wohr,’s gitt menggi Churzwiil mehr
am Sunntig noo der Chinderlehr;
un strömt. der füürig Iisebach
im Sand, es isch e schöni Sach.
Froog mengge Maa: „Sag, Nochber, he!
hesch au scho ’s Iise werde seh
im füürige Strom, de Forme noo?“
Was gilt’s, er cha nit sage: Jo!
Mir wüsse, wie rne’s Iise macht,
un wie’s im Sand zue Maaßle bacht,
un wie me’s druf in d’Schmidte bringt
un d’Luppen unterm Hammer zwingt.
Jetz schenket ii un stoßet a:
Der Hammermaister isch au ne Maa!
Wär Hammerschmid un Zainer nit,
do läg e Sach, was tät me mit?
Wie gieng’s im brave Hamberchsmaa?
,s mueß jede Stahl un lise ha;
un het der Schniider kai Noodle meh,
sen isch’s au uni sy Nahrig gscheh.
Un wenn im früeihe Morgerot
der Buur in Feld un Fure stoht,
se mueß er Charst un Haue ha,
sust isch er e verlorene Maa.
Zuem Brooche bruucht er d’Wägese,
zuem Mäihe bruucht er d’Sägese,
un d’Sichle, wenn der Waize blaicht,
un’s Messer, wenn der Trüübel waicht.
Se schneidet denn un schrnidet ihr,
un dank ich Gott der Heer derfür!
Un mach en andre Sichle druus,
un was me bruucht in Feld un Huus !
Un nurnme kaini Säbel meh!
`s het Wunde gnueg un Schmerze gee;
`s hinkt menggen ohni Fueß un Hand,
un mengge schlooft im tiefe Sand.
Kai Hurlibaus, ke Füsi meh!
Mer henn’s Lamento öbbe gsch
un gehört, wie’s in de Berge chracht,
un Ängste gha die ganzi Nacht
un glitte, was me liide cha;
drum schenket ii un stoßet a:
Uf Völkerfrid un Ainigkait
vo nun a bis in Ewigkait!
Jetz zahle mer! Jetz göhmer hai
un schaffe hüt no allerlai
un dengle no bis tief in d’Nacht
un mäihe, wenn der Tag verwacht.