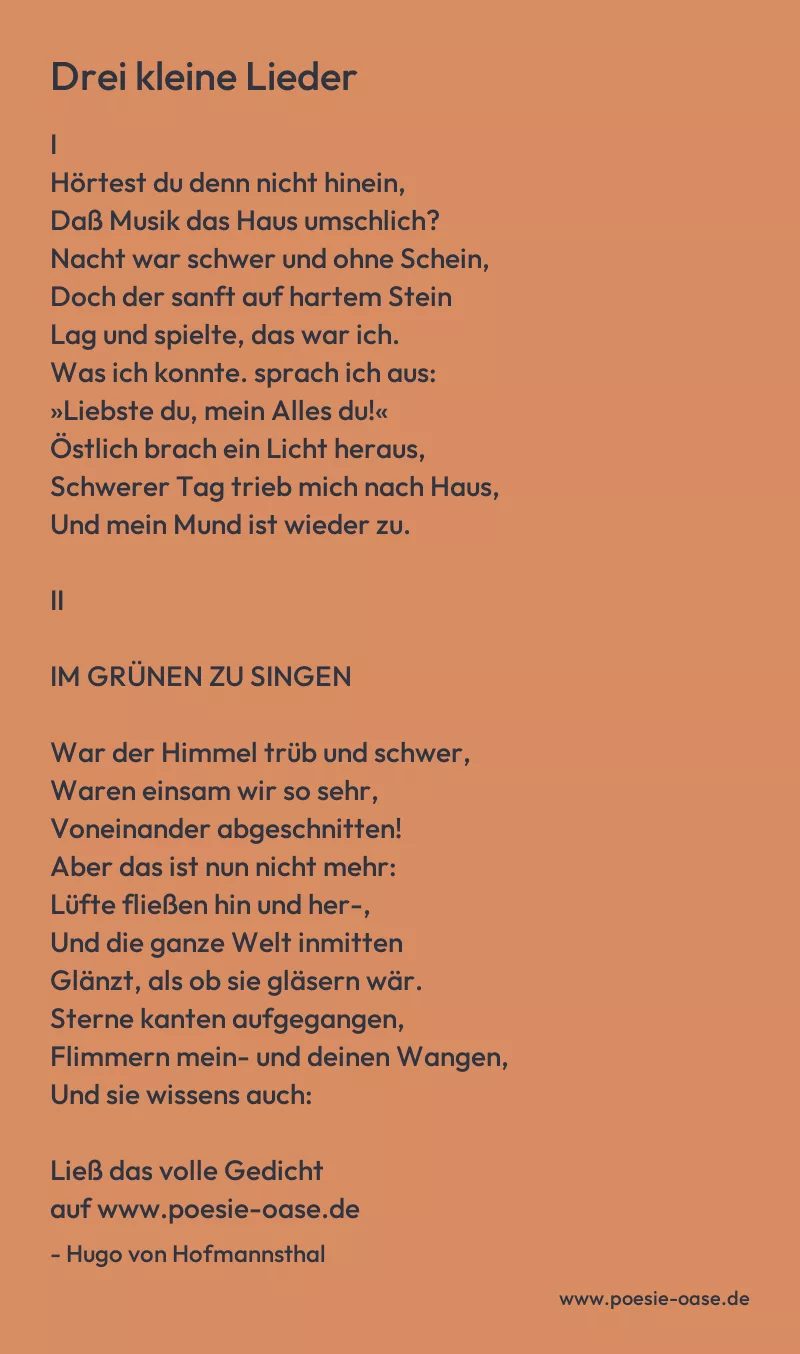Berge & Täler, Einsamkeit, Feiern, Freiheit & Sehnsucht, Götter, Harmonie, Himmel & Wolken, Leichtigkeit, Leidenschaft, Universum, Unschuld
Drei kleine Lieder
I
Hörtest du denn nicht hinein,
Daß Musik das Haus umschlich?
Nacht war schwer und ohne Schein,
Doch der sanft auf hartem Stein
Lag und spielte, das war ich.
Was ich konnte. sprach ich aus:
»Liebste du, mein Alles du!«
Östlich brach ein Licht heraus,
Schwerer Tag trieb mich nach Haus,
Und mein Mund ist wieder zu.
II
IM GRÜNEN ZU SINGEN
War der Himmel trüb und schwer,
Waren einsam wir so sehr,
Voneinander abgeschnitten!
Aber das ist nun nicht mehr:
Lüfte fließen hin und her-,
Und die ganze Welt inmitten
Glänzt, als ob sie gläsern wär.
Sterne kanten aufgegangen,
Flimmern mein- und deinen Wangen,
Und sie wissens auch:
Stark und stärker wird ihr Prangen;
Und wir atmen mit Verlangen,
Liegen selig wie gefangen.
Spüren eins des andern Hauch.
III
Die Liebste sprach: »Ich halt dich nicht,
Du hast mir nichts geschworn.
Die Menschen soll man halten nicht,
Sind nicht zur Treu geborn.
Zieh deine Straßen hin, mein Freund,
Beschau dir Land um Land,
In vielen Betten ruh dich aus,
Viel Frauen nimm bei der Hand.
Wo dir der Wein zu sauer ist,
Da trink du Malvasier,
Und wenn mein Mund dir süßer ist,
So komm nur wieder zu mir!«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
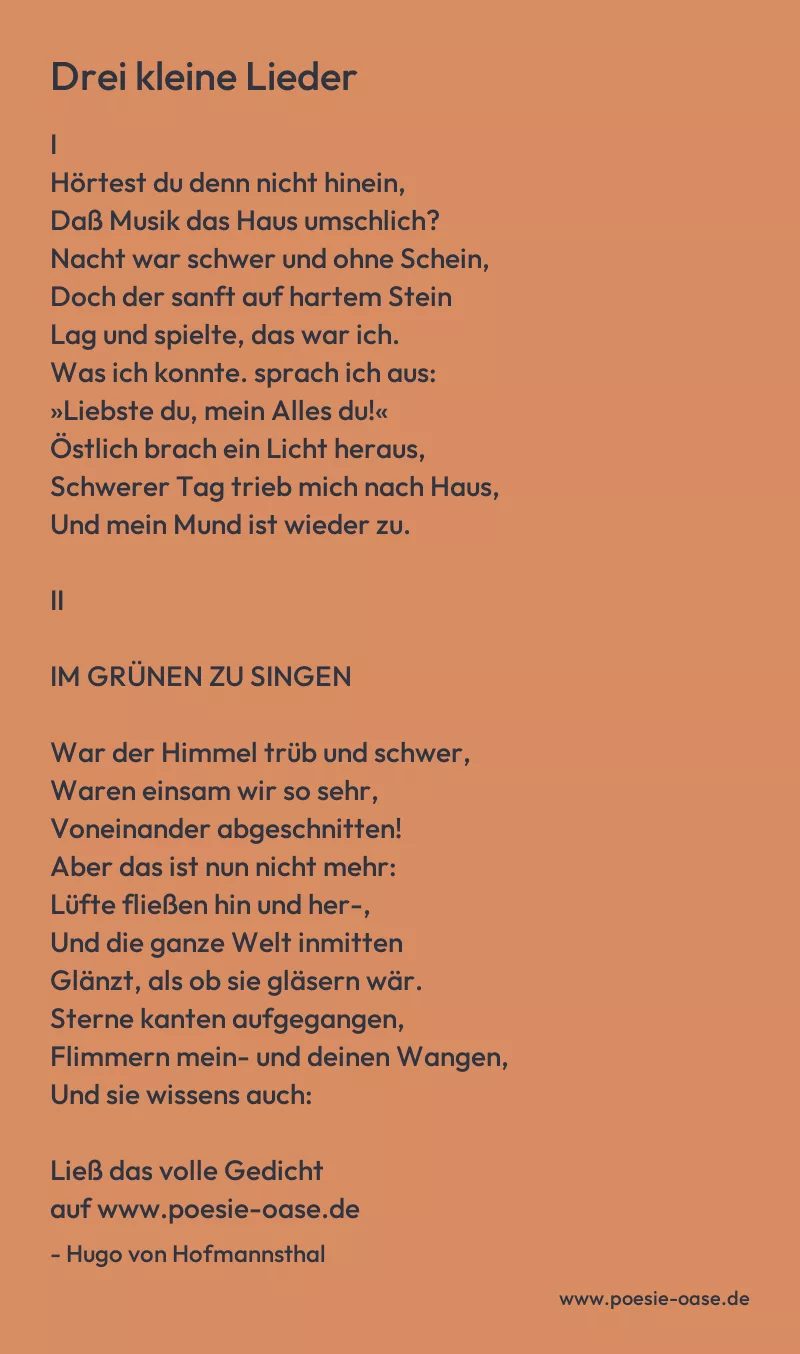
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Drei kleine Lieder“ von Hugo von Hofmannsthal präsentiert in drei Teilen verschiedene Facetten von Liebe, Sehnsucht und Freiheit. Der erste Teil zeichnet ein Bild heimlicher Liebe und des flüchtigen Glücks. Ein Ich-Erzähler lauscht in die Dunkelheit, umgeben von Musik, und flüstert seiner Geliebten seine Zuneigung zu. Das kurze Glück wird vom Anbruch des Tages unterbrochen, was die Vergänglichkeit und das Geheimnis der Liebe betont, die nur im Schutz der Nacht Bestand hat. Der „schwere Tag“ treibt das lyrische Ich zurück in die Stille, und sein Mund, der eben noch seine Liebe aussprach, verstummt wieder.
Der zweite Teil, „IM GRÜNEN ZU SINGEN“, kontrastiert die Einsamkeit mit einem Gefühl der Verbundenheit und des Aufbruchs. Die Trübsal der Vergangenheit weicht einem Gefühl des Glanzes und der Klarheit, symbolisiert durch die „gläsern“ erscheinende Welt. Die Liebenden finden Trost in der Natur, die durch die aufgehenden Sterne eine magische Atmosphäre schafft. Das lyrische Ich und seine Geliebte verschmelzen in dieser idyllischen Szene, und die Liebe wird als ein Zustand des Glücks und der Freiheit beschrieben. Die Zeilen vermitteln eine tiefe Sehnsucht nach Harmonie und Einheit, die über die physischen Grenzen hinausreicht.
Der dritte Teil bricht mit der romantischen Idealisierung und präsentiert eine paradoxe Vorstellung von Liebe und Freiheit. Die Geliebte spricht von Freiheit und der Auflösung von Bindungen. Sie ermutigt den Geliebten, die Welt zu erkunden, andere Beziehungen einzugehen und sich in verschiedenen Erfahrungen zu verlieren. Die scheinbare Großzügigkeit und Toleranz verbergen jedoch eine tiefere Einsicht in die Natur der Liebe und die menschliche Sehnsucht nach Individualität. Der „Malvasier“ und der „süße Mund“ der Geliebten implizieren die Möglichkeit der Rückkehr, was das Gedicht mit einer Ambivalenz und einer offenen Struktur abschließt.
Hofmannsthals Gedicht zeichnet sich durch seine subtile Sprachgestaltung und seine Fähigkeit aus, komplexe Emotionen in kurzen, prägnanten Versen zu erfassen. Die drei Teile bilden eine Entwicklung von der geheimen Sehnsucht über die Vereinigung in der Natur bis hin zur Auseinandersetzung mit der Freiheit und den Widersprüchen der Liebe. Durch die Verwendung von einfachen, aber eindringlichen Bildern und einer klaren Sprache gelingt es Hofmannsthal, die verschiedenen Aspekte der Liebe und der menschlichen Existenz auf berührende Weise zu erfassen. Das Gedicht wirft Fragen nach den Regeln der Liebe, dem Wunsch nach Freiheit und der Sehnsucht nach Verbundenheit auf.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.