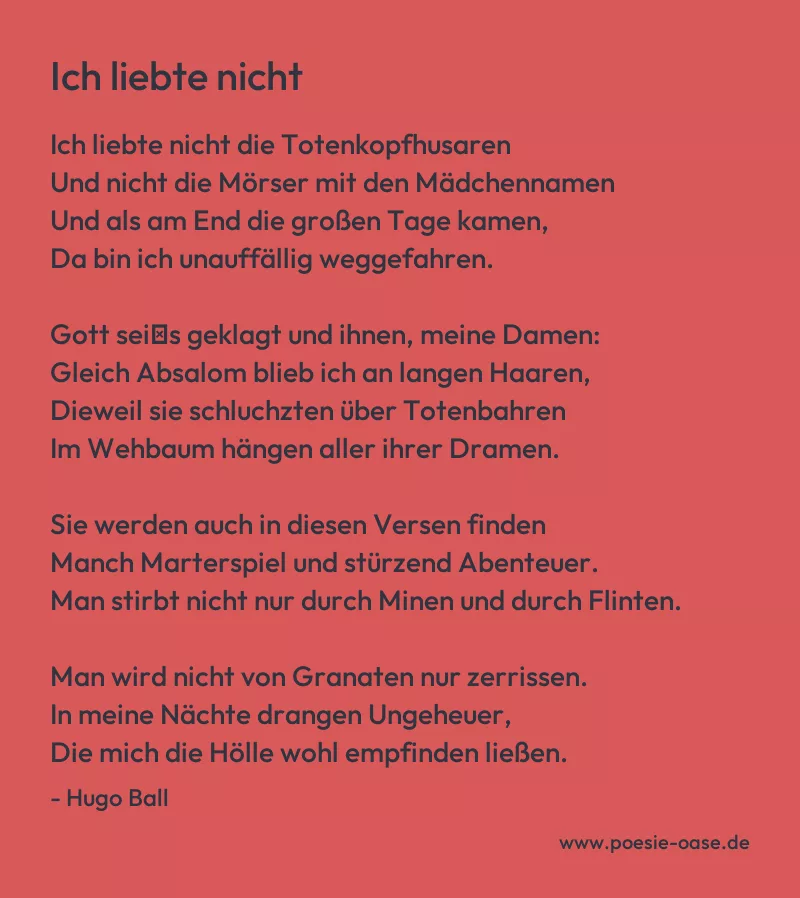Ich liebte nicht
Ich liebte nicht die Totenkopfhusaren
Und nicht die Mörser mit den Mädchennamen
Und als am End die großen Tage kamen,
Da bin ich unauffällig weggefahren.
Gott sei′s geklagt und ihnen, meine Damen:
Gleich Absalom blieb ich an langen Haaren,
Dieweil sie schluchzten über Totenbahren
Im Wehbaum hängen aller ihrer Dramen.
Sie werden auch in diesen Versen finden
Manch Marterspiel und stürzend Abenteuer.
Man stirbt nicht nur durch Minen und durch Flinten.
Man wird nicht von Granaten nur zerrissen.
In meine Nächte drangen Ungeheuer,
Die mich die Hölle wohl empfinden ließen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
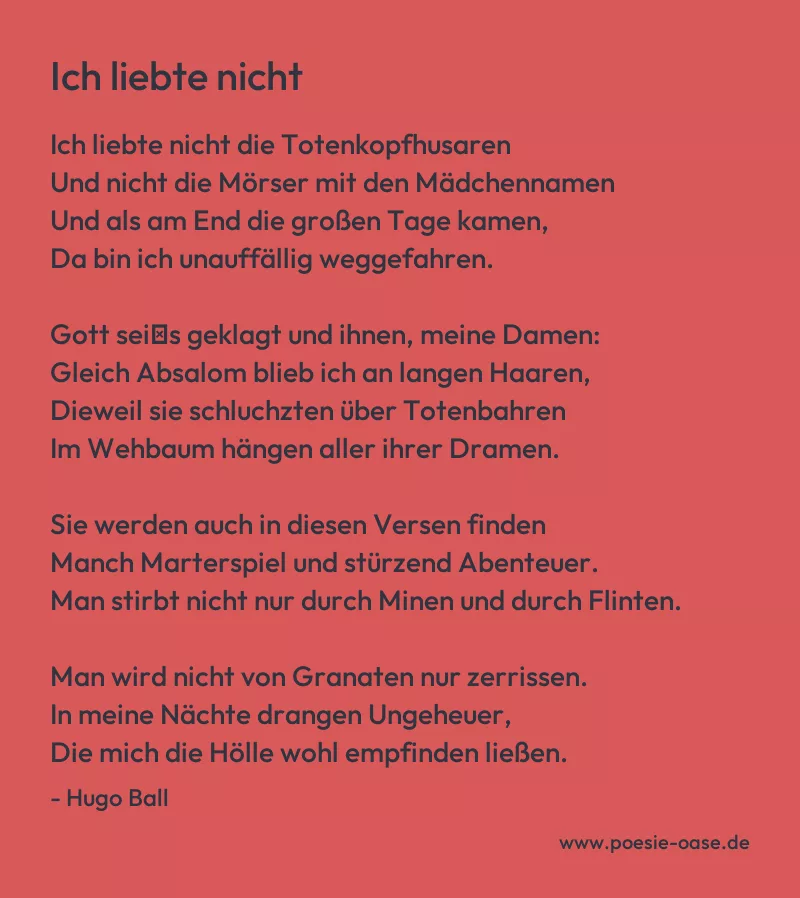
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich liebte nicht“ von Hugo Ball präsentiert eine Ablehnung von Krieg und konventionellen Werten, gepaart mit einer Auseinandersetzung mit inneren Dämonen und persönlichem Leid. Die ersten vier Verse etablieren eine Distanzierung von militaristischen Symbolen wie „Totenkopfhusaren“ und „Mörsern mit den Mädchennamen“, die den Krieg verharmlosen. Der Erzähler distanziert sich nicht nur von der militärischen Gewalt, sondern auch von den sozialen Normen, die diese Gewalt verherrlichen. Seine Reaktion auf den Ausbruch der „großen Tage“ – wahrscheinlich des Ersten Weltkriegs – ist die passive Flucht, das „unauffällige Wegfahren“.
Die zweite Strophe verstärkt die Kritik an denjenigen, die in traditionellen, kriegerischen Szenarien ihren Reiz finden. Ball beschreibt die Trauer derer, die den Krieg idealisieren oder ihm gar dienen. Die Analogie zu Absalom, der an seinen Haaren hing, verdeutlicht die Gefangenschaft in diesem Kreislauf aus Leid und Trauer. Der Erzähler, der sich von all dem lossagt, wird zum Außenseiter, der die „Dramen“ der Anderen aus einer distanzierten Perspektive betrachtet. Der „Wehbaum“ als Metapher für die Trauer und die emotionalen Turbulenzen unterstreicht das Leid, das durch Krieg und die damit verbundenen Emotionen verursacht wird.
In der dritten Strophe vollzieht sich eine Verschiebung von der äußeren Ablehnung hin zu einer Auseinandersetzung mit inneren Kämpfen. Ball spricht von „Marterspiel“ und „stürzenden Abenteuern“, die das Leid des Erzählers beschreiben. Er betont, dass das Sterben nicht nur durch physische Gewalt erfolgt („Minen und durch Flinten“), sondern auch durch innere Dämonen. Die letzten beiden Verse deuten auf eine persönliche Hölle hin, verursacht durch „Ungeheuer“, die in seine Nächte drangen. Dies deutet darauf hin, dass Ball nicht nur den äußeren Krieg, sondern auch die inneren Kämpfe und Ängste, die ihn quälten, verarbeitete.
Das Gedicht ist somit eine doppelte Verneinung: Ablehnung des äußeren Krieges und seiner Konventionen, sowie eine Auseinandersetzung mit inneren Dämonen, die dem Erzähler die „Hölle wohl empfinden ließen“. Ball verwendet eine einfache, aber eindringliche Sprache, die von Ironie und Melancholie geprägt ist, um seine kritische Haltung gegenüber Krieg und Gesellschaft auszudrücken. Das Gedicht ist ein Zeugnis seiner persönlichen Erfahrungen und der inneren Zerrissenheit, die durch die Kriegszeit und die allgemeine Sinnkrise ausgelöst wurden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.