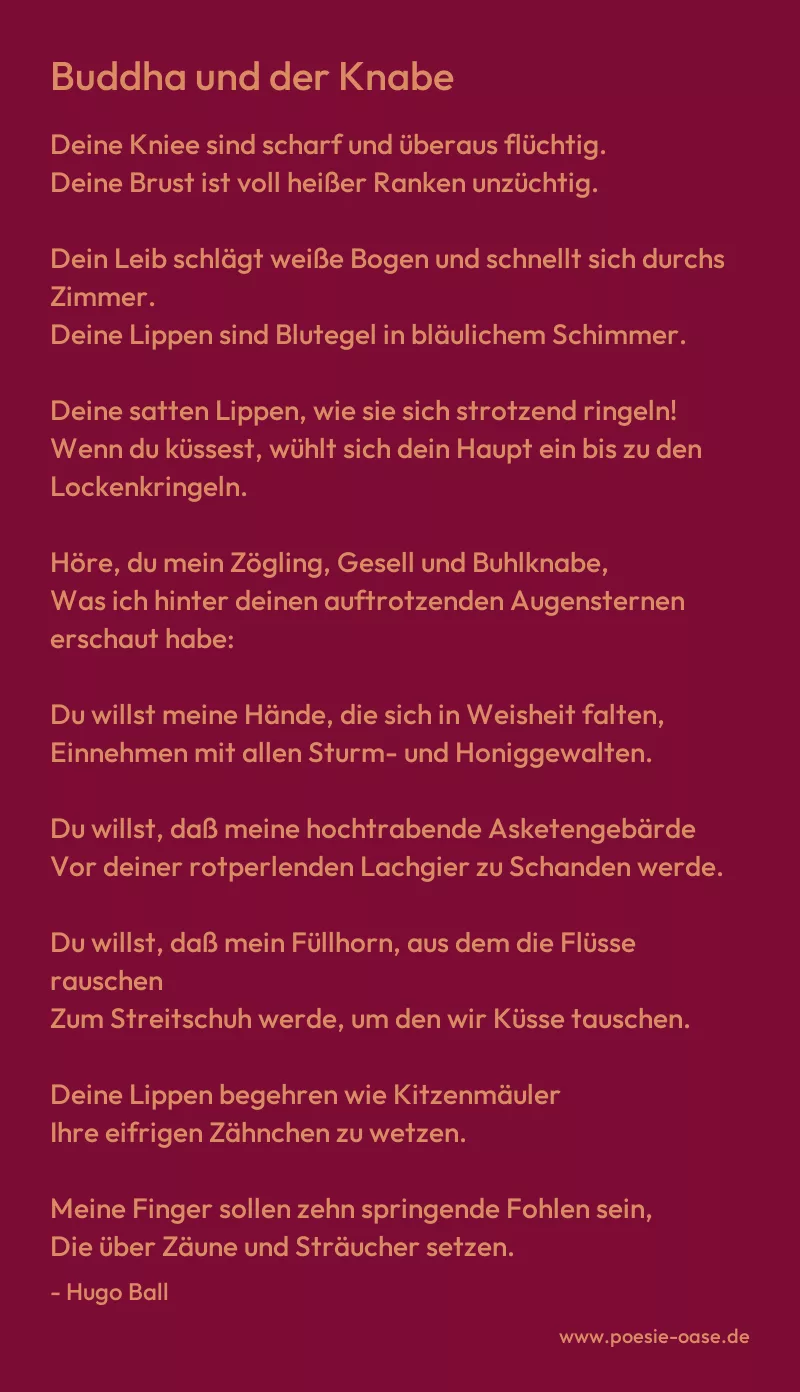Buddha und der Knabe
Deine Kniee sind scharf und überaus flüchtig.
Deine Brust ist voll heißer Ranken unzüchtig.
Dein Leib schlägt weiße Bogen und schnellt sich durchs Zimmer.
Deine Lippen sind Blutegel in bläulichem Schimmer.
Deine satten Lippen, wie sie sich strotzend ringeln!
Wenn du küssest, wühlt sich dein Haupt ein bis zu den Lockenkringeln.
Höre, du mein Zögling, Gesell und Buhlknabe,
Was ich hinter deinen auftrotzenden Augensternen erschaut habe:
Du willst meine Hände, die sich in Weisheit falten,
Einnehmen mit allen Sturm- und Honiggewalten.
Du willst, daß meine hochtrabende Asketengebärde
Vor deiner rotperlenden Lachgier zu Schanden werde.
Du willst, daß mein Füllhorn, aus dem die Flüsse rauschen
Zum Streitschuh werde, um den wir Küsse tauschen.
Deine Lippen begehren wie Kitzenmäuler
Ihre eifrigen Zähnchen zu wetzen.
Meine Finger sollen zehn springende Fohlen sein,
Die über Zäune und Sträucher setzen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
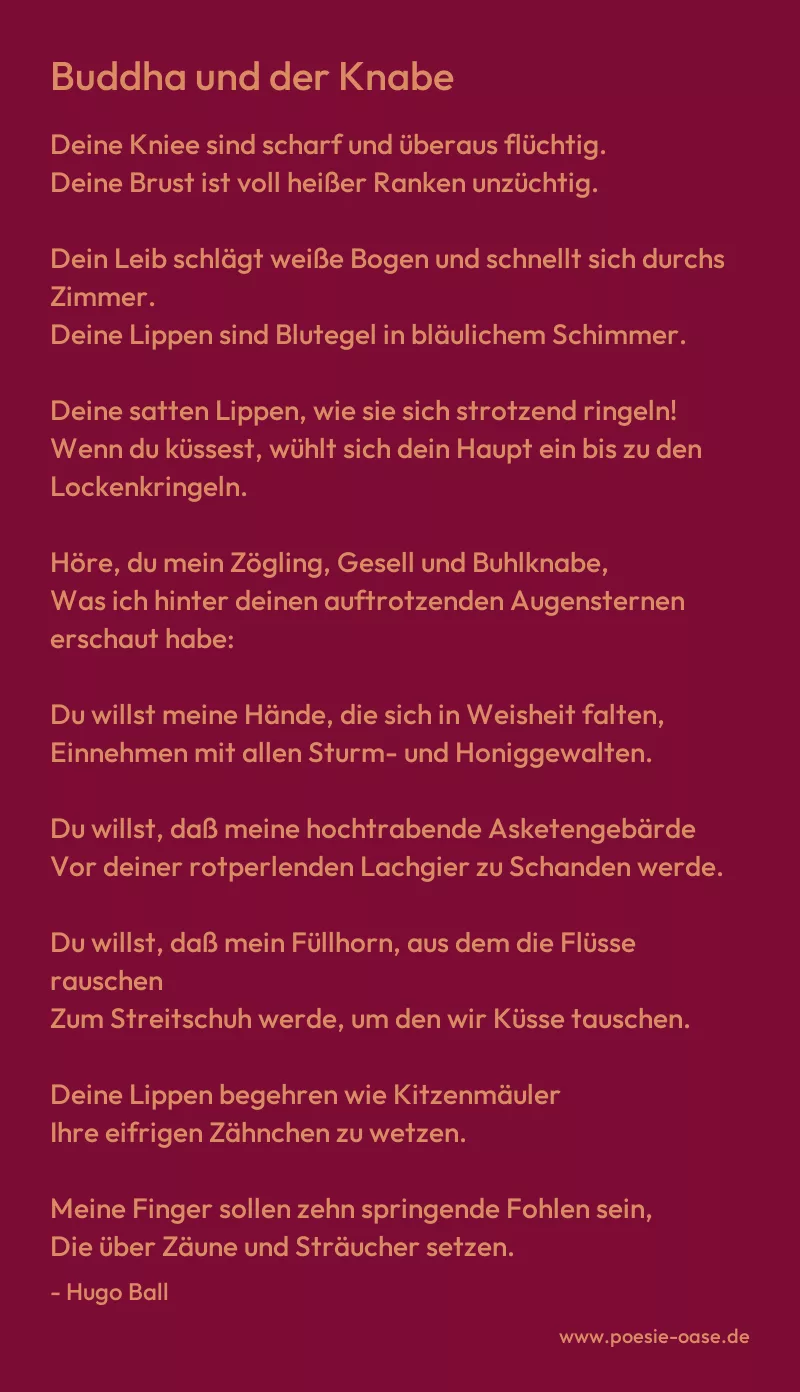
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Buddha und der Knabe“ von Hugo Ball ist eine Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen Askese und Sinnlichkeit, personifiziert durch die Figuren des Buddhas und eines jungen Knaben. Das Gedicht nutzt eine bildreiche Sprache, um die Anziehungskraft und den Verführungswillen des Knaben sowie die innere Auseinandersetzung des Buddha mit diesen Reizen darzustellen.
Der Knabe wird mit Metaphern geschildert, die seine jugendliche Energie und seinen körperlichen Reiz hervorheben. Begriffe wie „scharf“, „flüchtig“, „heißer Ranken unzüchtig“, „weiße Bogen“, „Blutegel“, „strotzend ringeln“ und „Kitzenmäuler“ erzeugen ein lebendiges Bild von jugendlicher Vitalität und sexueller Anziehungskraft. Diese Bilder stehen im Kontrast zur traditionellen Darstellung eines Buddhas, der für Weisheit, Meditation und Abkehr von weltlichen Begierden steht. Die Sprache des Gedichts suggeriert eine gewisse Obszönität, was das Wesen des Gedichts, die Verlockung der körperlichen Begierden, unterstreicht.
Der Buddha scheint dem Knaben zunächst widerstehen zu wollen. Die Zeilen „Du willst meine Hände, die sich in Weisheit falten“ und „Du willst, daß meine hochtrabende Asketengebärde / Vor deiner rotperlenden Lachgier zu Schanden werde“ zeigen den Konflikt zwischen den asketischen Prinzipien des Buddha und der verführerischen Kraft des Knaben. Der Buddha scheint zu erkennen, dass der Knabe versucht, seine geistige Disziplin zu untergraben. Er scheint sich der Gefahr bewusst, dass der Knabe versucht, seine Haltung der Abstinenz und Askese in Frage zu stellen.
Die abschließenden Verse deuten auf ein Nachgeben oder zumindest einen inneren Kampf des Buddhas. Die Vorstellung, dass seine „Finger […] zehn springende Fohlen sein“ sollen, deutet auf ein Aufbrechen der starren Askese und eine Hinwendung zu spielerischer Sinnlichkeit. Diese Zeilen lassen eine Ambivalenz erkennen, die ein zentrales Thema des Gedichts ist: das Spannungsverhältnis zwischen weltlichen Begierden und spiritueller Erleuchtung. Das Gedicht endet offen, ohne eine klare Auflösung dieses Konflikts, was dem Leser Raum für eigene Interpretationen lässt und die bleibende Relevanz dieses inneren Kampfes im menschlichen Leben verdeutlicht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.