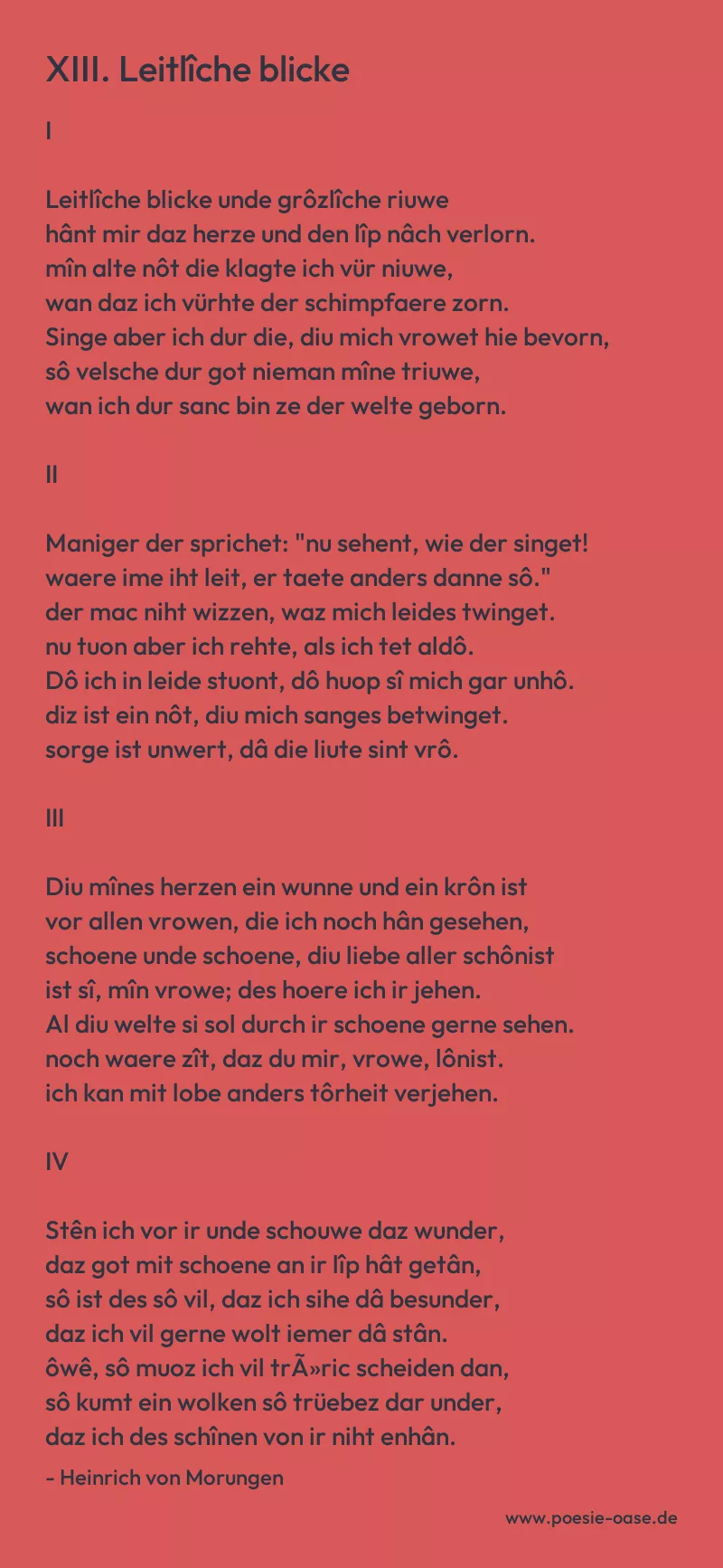XIII. Leitlîche blicke
I
Leitlîche blicke unde grôzlîche riuwe
hânt mir daz herze und den lîp nâch verlorn.
mîn alte nôt die klagte ich vür niuwe,
wan daz ich vürhte der schimpfaere zorn.
Singe aber ich dur die, diu mich vrowet hie bevorn,
sô velsche dur got nieman mîne triuwe,
wan ich dur sanc bin ze der welte geborn.
II
Maniger der sprichet: „nu sehent, wie der singet!
waere ime iht leit, er taete anders danne sô.“
der mac niht wizzen, waz mich leides twinget.
nu tuon aber ich rehte, als ich tet aldô.
Dô ich in leide stuont, dô huop sî mich gar unhô.
diz ist ein nôt, diu mich sanges betwinget.
sorge ist unwert, dâ die liute sint vrô.
III
Diu mînes herzen ein wunne und ein krôn ist
vor allen vrowen, die ich noch hân gesehen,
schoene unde schoene, diu liebe aller schônist
ist sî, mîn vrowe; des hoere ich ir jehen.
Al diu welte si sol durch ir schoene gerne sehen.
noch waere zît, daz du mir, vrowe, lônist.
ich kan mit lobe anders tôrheit verjehen.
IV
Stên ich vor ir unde schouwe daz wunder,
daz got mit schoene an ir lîp hât getân,
sô ist des sô vil, daz ich sihe dâ besunder,
daz ich vil gerne wolt iemer dâ stân.
ôwê, sô muoz ich vil trûric scheiden dan,
sô kumt ein wolken sô trüebez dar under,
daz ich des schînen von ir niht enhân.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
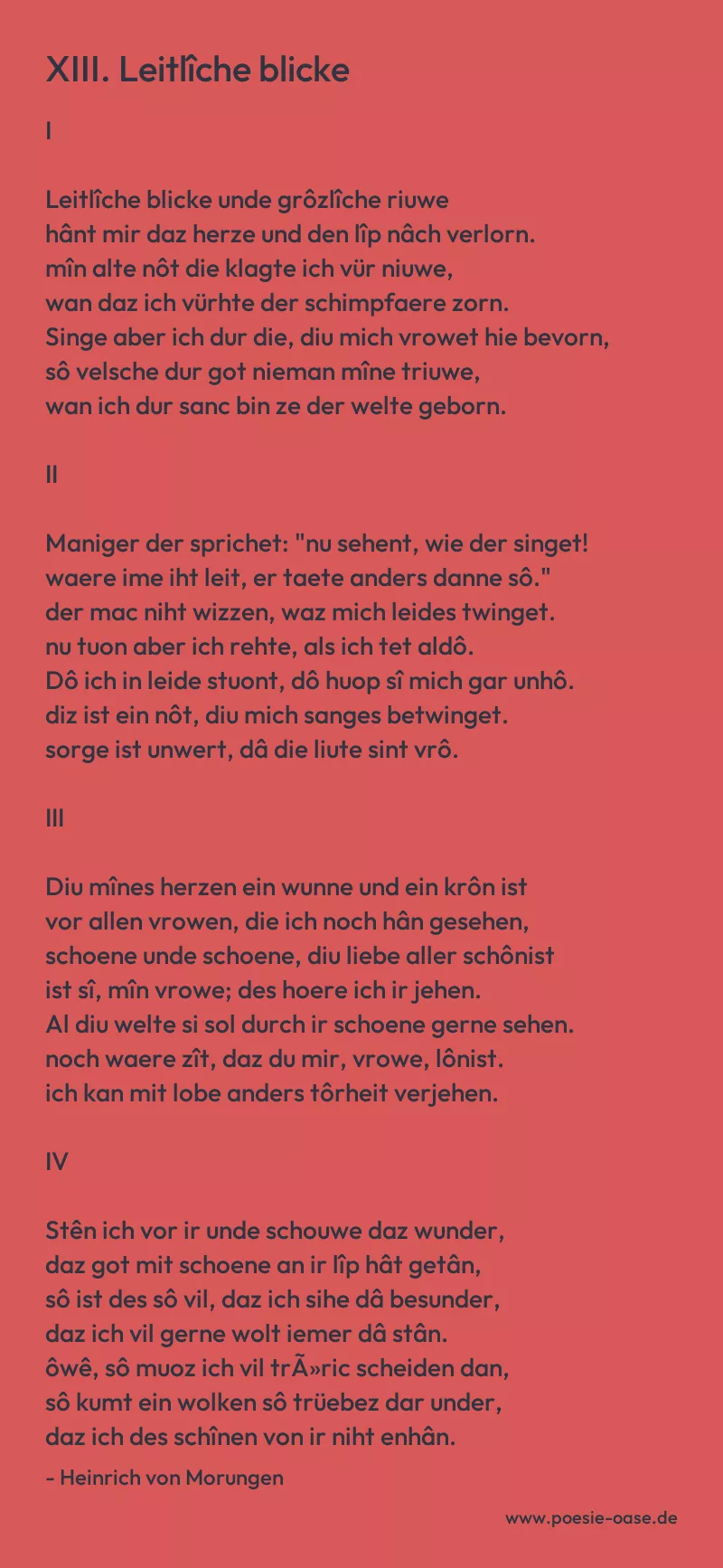
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „XIII. Leitlîche blicke“ von Heinrich von Morungen ist eine eindringliche Liebesklage, die von einem Wechselspiel zwischen Freude und Schmerz, Sehnsucht und unerfüllter Liebe geprägt ist. Es offenbart die Zerrissenheit des lyrischen Ichs, das zwischen seiner Liebe zu einer unerreichbaren Frau und den daraus resultierenden Leiden schwankt. Die formale Struktur des Gedichts, insbesondere die gleichbleibende Reimform und die strohigen Abschnitte, verstärkt den Eindruck von Stabilität inmitten der emotionalen Turbulenzen.
Der erste Abschnitt etabliert sofort die ambivalente Gefühlslage des Sprechers. „Leitlîche blicke unde grôzlîche riuwe“ (Liebevolle Blicke und große Reue) eröffnen das Gedicht und deuten auf die Ursache des Leids hin: die Liebe zu einer Frau, die sowohl Freude als auch Schmerz verursacht. Das lyrische Ich ist innerlich zerrissen und versucht, seine Gefühle zu verbergen, aus Furcht vor der Spottlust anderer. Die Zeile „wan ich dur sanc bin ze der welte geborn“ (denn ich bin durch den Gesang für die Welt geboren) deutet darauf hin, dass der Gesang, die Kunst, für den Sprecher ein Mittel ist, seine Emotionen auszudrücken und seine Erlebnisse zu verarbeiten, obwohl er die Möglichkeit des Spottes befürchtet.
Der zweite Abschnitt thematisiert die Wahrnehmung des Sprechers durch andere. Er wird von Menschen beobachtet, die sein Verhalten als widersprüchlich ansehen, da sie nicht verstehen, was er wirklich fühlt. „Der mac niht wizzen, waz mich leides twinget“ (Der kann nicht wissen, was mich an Leid zwingt) drückt die Kluft zwischen dem Inneren des Sprechers und der äußeren Wahrnehmung aus. Er betont, dass er trotz seines Leids weiter singen muss, da dies seine Art ist, mit seiner Liebe und seinem Schmerz umzugehen. Das Paradox ist, dass er singen muss, weil er leidet, und doch ist es seine Kunst, die ihn am Leben erhält und ihm erlaubt, seine Gefühle auszudrücken.
Im dritten und vierten Abschnitt konzentriert sich das Gedicht auf die geliebte Frau, die als „wunne und ein krôn“ (Wonne und Krone) beschrieben wird. Das lyrische Ich schwärmt von ihrer Schönheit und wünscht sich, ihre Liebe zu verdienen. Die Zeile „noch waere zît, daz du mir, vrowe, lônist“ (noch wäre Zeit, dass du mir, Frau, Lohn gibst) drückt die Hoffnung auf eine Gegenleistung, eine Erwiderung seiner Liebe aus. Die abschließende Strophe verdeutlicht jedoch das Dilemma: Das lyrische Ich befindet sich in ihrer Gegenwart, genießt die Schönheit, die sie ausstrahlt, muss sich aber von ihr trennen. Ein „wolken sô trüebez“ (Wolke so trübe) wirft einen Schatten auf das Glück, was die Trennung symbolisiert und die Trauer und das unerfüllte Verlangen des Sprechers unterstreicht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.