Wärt ihr der Leidenschaft selbst, der gewaltigen, fähig, ich sänge,
Daphne, beim Himmel, und was jüngst auf den Triften geschehn.
Vokation
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
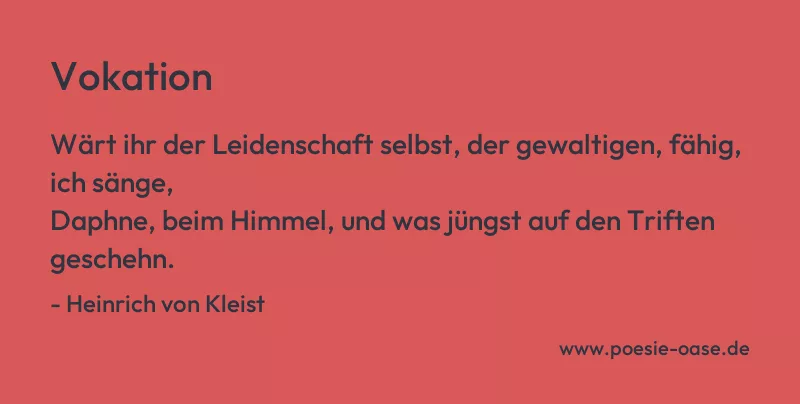
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vokation“ von Heinrich von Kleist, das in seiner Kürze und Direktheit besticht, ist eine Anrufung und ein Versprechen. Es ist ein Aufruf an die Fähigkeit zur Leidenschaft und ein Hinweis auf die Themen, die der Dichter in seinem Werk ansprechen möchte. Die ersten Worte „Wärt ihr der Leidenschaft selbst, der gewaltigen, fähig, ich sänge,“ sind ein Schlüssel, der die Türen zu Kleists künstlerischer Welt öffnet. Hier spricht der Dichter, der Sänger, von einer Möglichkeit, von einer Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Kunst entstehen kann.
Die Anrede „Daphne, beim Himmel“ deutet auf eine mythische oder klassische Thematik hin. Daphne, die in der griechischen Mythologie vor Apoll flieht und sich in einen Lorbeerbaum verwandelt, steht für eine Geschichte der Verfolgung, der Verwandlung und der Tragödie. Die Nennung von Daphne signalisiert die Verbindung des Dichters zur Antike und zu den Themen, die diese Epoche geprägt haben: Liebe, Leidenschaft, Schicksal und die Auseinandersetzung mit den Göttern. Durch diese Anrufung wird das Gedicht in einen höheren Kontext gestellt, ein Versprechen, dass die Kunst von Kleist sich mit den großen Themen der Menschheit auseinandersetzen wird.
Der zweite Vers, „und was jüngst auf den Triften geschehn“, ist von besonderer Bedeutung, da er die thematische Ausrichtung des Dichters konkretisiert. Die „Triften“ (Weiden, grasbewachsene Flächen) stehen oft im Kontext einer idyllischen, ländlichen Umgebung. Das „was jüngst geschehn“ lässt Raum für Interpretationen: Es könnte sich auf jüngste Ereignisse in der Natur, auf menschliche Dramen oder auf die aktuelle politische oder gesellschaftliche Situation beziehen. Dieses „was“ deutet auf eine aktuelle oder kürzlich stattgefundene Handlung, einen Vorfall oder ein Erlebnis hin, welches das Potenzial hat, in einem Gedicht verewigt zu werden. Die Kürze des Verses legt den Schluss nahe, dass es um eine kürzliche, bedeutsame und vor allem leidenschaftliche Erfahrung geht, die den Dichter zum Schreiben anregt.
In der Gesamtheit betrachtet, formuliert Kleist mit diesen wenigen Worten eine programmatische Aussage über seine Kunst. Die Verbindung von Leidenschaft, mythischen Themen und dem Anspruch, die Realität in ihrer ganzen Intensität zu erfassen, macht dieses Gedicht zu einem Manifest seiner künstlerischen Vision. Es ist ein Bekenntnis zur Auseinandersetzung mit den großen Gefühlen und Ereignissen der Welt, zur Ehrlichkeit und zur Aufrichtigkeit in der Darstellung des menschlichen Lebens. Der Dichter verspricht, wenn die Leidenschaft vorhanden ist, die Themen der Tragödie, des Wandels und der Liebe zu besingen, und somit das menschliche Dasein in all seinen Facetten zu erfassen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
