Himmel, welch eine Pein sie fühlt! Sie hat so viel Tugend
Immer gesprochen, daß ihr nun kein Verführer mehr naht.
Die Reuige
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
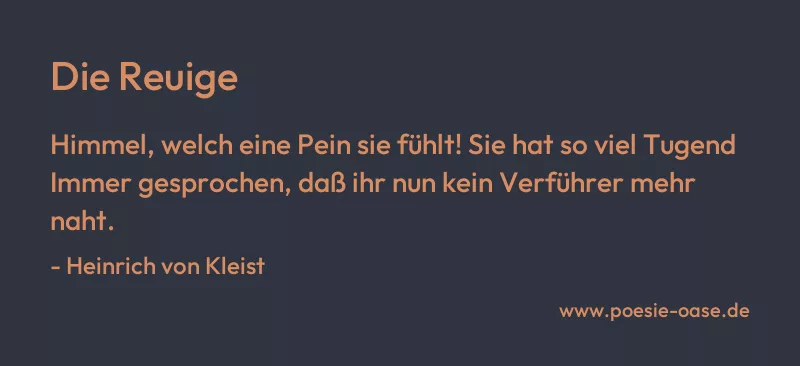
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Reuige“ von Heinrich von Kleist ist ein kurzes, doch prägnantes Werk, das sich mit dem Thema der Reue und der Selbsttäuschung auseinandersetzt. Es beginnt mit einem Ausruf, der die innere Qual der Protagonistin („sie“) hervorhebt. Der Ausdruck „Himmel, welch eine Pein sie fühlt!“ deutet auf ein tiefes Leid und eine schwere Last hin, die auf ihr lastet. Die Verwendung des Wortes „Pein“ (Qual) suggeriert ein seelisches Unbehagen und eine innere Zerrissenheit.
Der zweite Teil des Gedichts enthüllt die Ursache für dieses Leid. Die Zeile „Sie hat so viel Tugend / Immer gesprochen, daß ihr nun kein Verführer mehr naht“ offenbart eine Ironie, die typisch für Kleists Werk ist. Die Protagonistin scheint sich aufgrund ihrer übermäßigen Betonung ihrer Tugend in eine Position der Isolation manövriert zu haben. Durch das „immer gesprochen“ deutet der Vers an, dass sie ihre Tugend nicht nur gelebt, sondern auch andauernd zur Schau gestellt hat. Dies hat zur Folge, dass potenzielle „Verführer“ – also Personen, die Interesse an ihr hätten – von ihr abgewiesen oder abgeschreckt wurden.
Die zentrale Ironie des Gedichts liegt darin, dass die Protagonistin unter dem vermeintlichen Schutz ihrer Tugend leidet. Sie hat sich durch ihre vermeintliche moralische Überlegenheit von zwischenmenschlichen Beziehungen isoliert, was nun zu ihrem Leid führt. Kleist wirft hier Fragen nach der Echtheit von Tugend und der Gefahr der Selbstüberschätzung auf. Die Betonung des Redens über Tugend, anstatt sie zu leben, deutet auf eine mögliche Heuchelei oder zumindest eine Verkennung der eigenen Motive hin.
Das Gedicht lässt viele Fragen offen und bietet keine einfachen Antworten. Es ist ein Appell an die Selbstreflexion und die Erkenntnis, dass menschliches Verhalten oft widersprüchlich und komplex ist. Kleist deutet an, dass die Überbetonung von Tugend nicht nur eine Reaktion auf das eigene Verhalten ist, sondern auch andere Menschen verprellt und somit auch die eigenen Lebensmöglichkeiten einschränkt. Die Reue der Protagonistin ist somit nicht nur auf eine bestimmte Tat zurückzuführen, sondern auf eine allgemeine Selbsttäuschung.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
