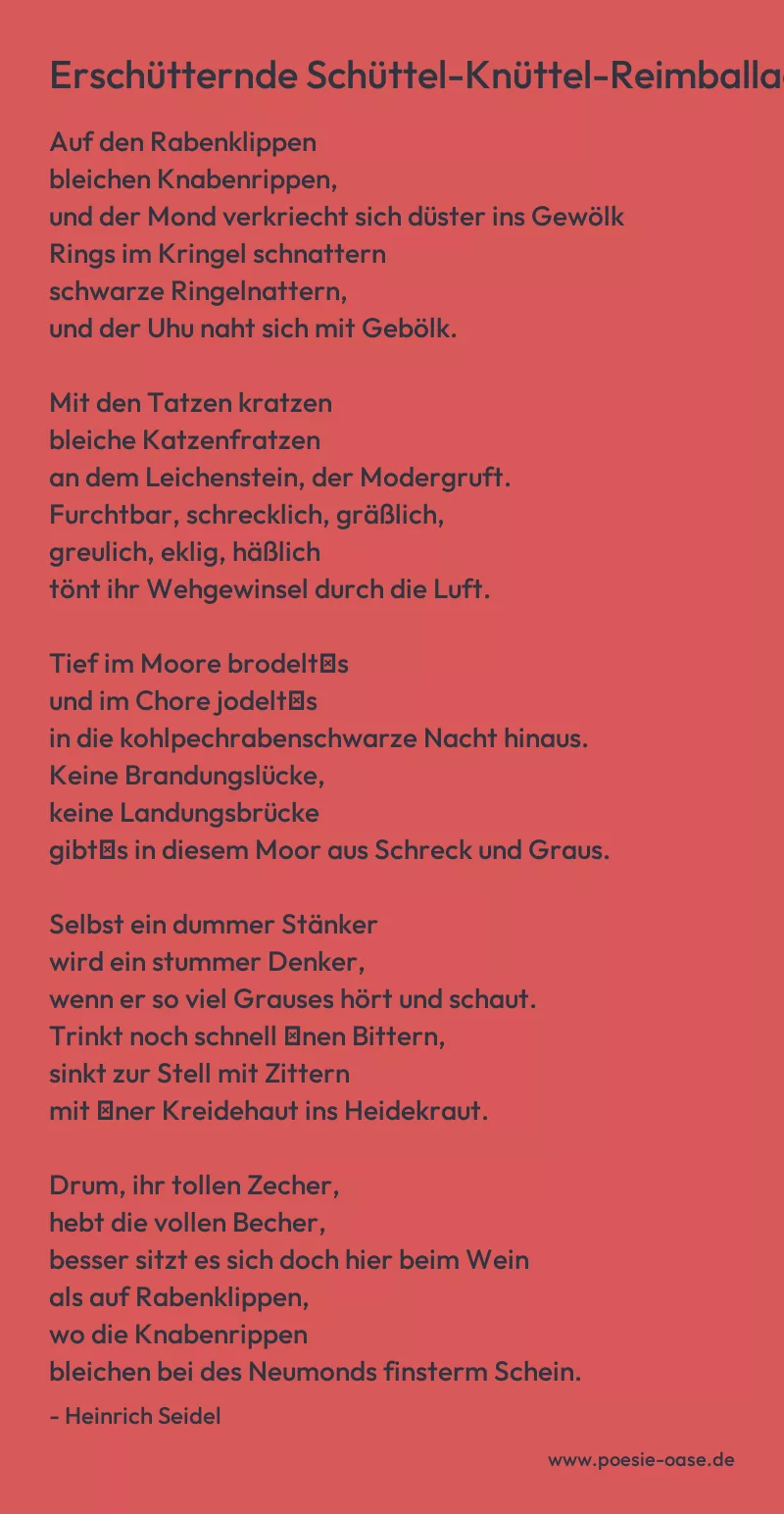Erschütternde Schüttel-Knüttel-Reimballade
Auf den Rabenklippen
bleichen Knabenrippen,
und der Mond verkriecht sich düster ins Gewölk
Rings im Kringel schnattern
schwarze Ringelnattern,
und der Uhu naht sich mit Gebölk.
Mit den Tatzen kratzen
bleiche Katzenfratzen
an dem Leichenstein, der Modergruft.
Furchtbar, schrecklich, gräßlich,
greulich, eklig, häßlich
tönt ihr Wehgewinsel durch die Luft.
Tief im Moore brodelt′s
und im Chore jodelt′s
in die kohlpechrabenschwarze Nacht hinaus.
Keine Brandungslücke,
keine Landungsbrücke
gibt′s in diesem Moor aus Schreck und Graus.
Selbst ein dummer Stänker
wird ein stummer Denker,
wenn er so viel Grauses hört und schaut.
Trinkt noch schnell ′nen Bittern,
sinkt zur Stell mit Zittern
mit ′ner Kreidehaut ins Heidekraut.
Drum, ihr tollen Zecher,
hebt die vollen Becher,
besser sitzt es sich doch hier beim Wein
als auf Rabenklippen,
wo die Knabenrippen
bleichen bei des Neumonds finsterm Schein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
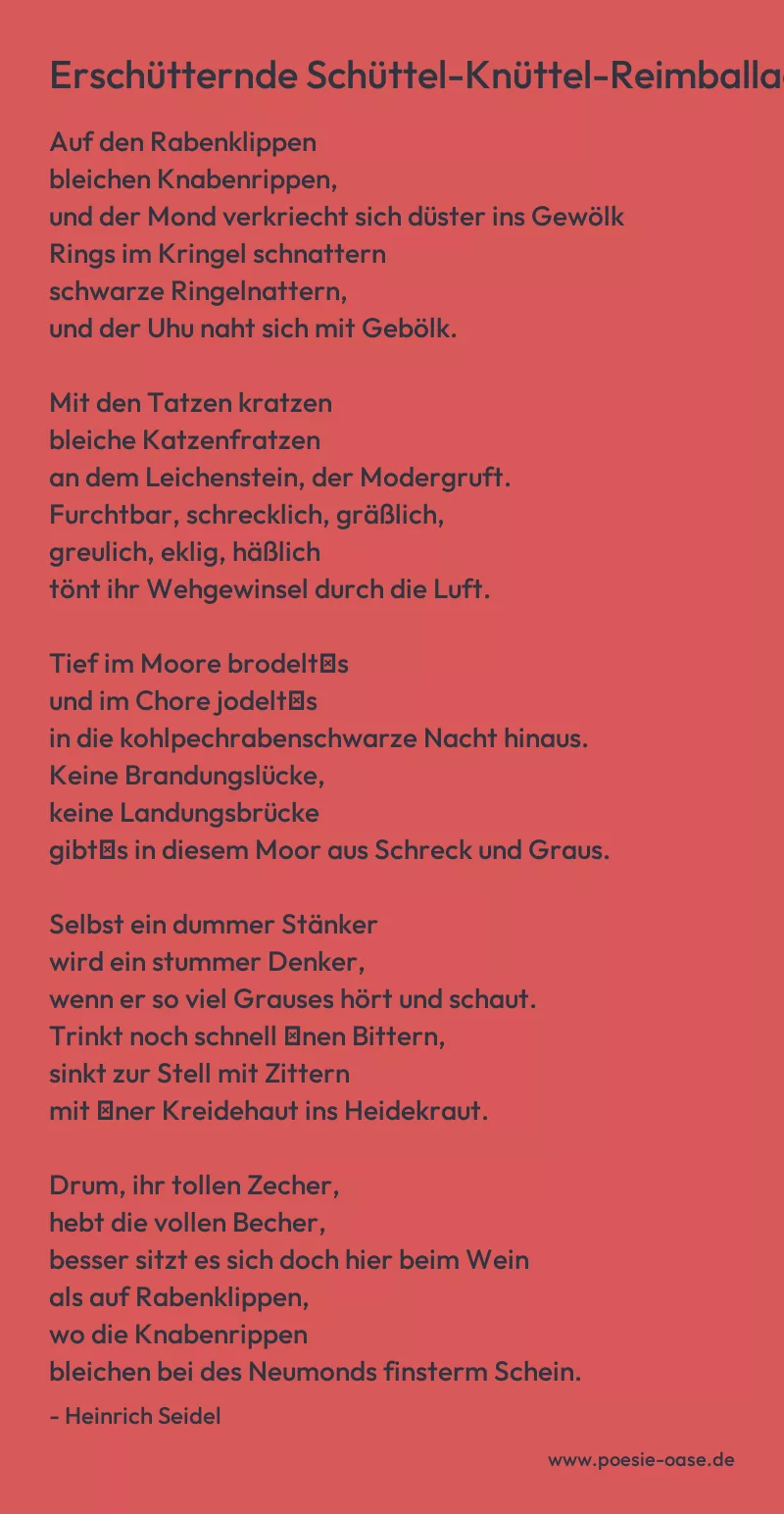
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Erschütternde Schüttel-Knüttel-Reimballade“ von Heinrich Seidel entwirft eine düstere und beklemmende Szenerie, die von Tod, Verwesung und dem unheimlichen Gesang der Natur geprägt ist. Die Ballade bedient sich einer Fülle von Bildern des Grauens, um eine Atmosphäre der Angst und des Schreckens zu erzeugen. Die Reime und der Rhythmus verstärken den Eindruck der Unheimlichkeit und tragen dazu bei, dass sich die Verse ins Gedächtnis einprägen.
Die beschriebene Landschaft wird von Anfang an durch die „Rabenklippen“ und die „Knabenrippen“ als Ort des Todes und des Verfalls gekennzeichnet. Dazu gesellen sich „schwarze Ringelnattern“, „Katzenfratzen“ und der „Uhu“, die das Bild der Verwesung und des Schreckens verstärken. Das „brodelnde Moor“ und die „kohlpechrabenschwarze Nacht“ unterstreichen die Monotonie der Szenerie und der Angst. Die Wiederholung von Adjektiven wie „furchtbar, schrecklich, gräßlich, greulich, eklig, häßlich“ erzeugt eine kumulative Wirkung und steigert das Gefühl des Abscheus.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird die Wirkung dieser grausamen Umgebung auf den Betrachter deutlich. Selbst ein „dummer Stänker“ verstummt und wird zum „stummen Denker“, was die Macht des Gezeigten verdeutlicht. Der Kontrast zwischen dem fröhlichen Beisammensein der Zecher und der unheimlichen Szenerie wird in den letzten Strophen herausgestellt. Die Warnung, die vom Gedicht ausgeht, ist deutlich: Besser ist es, im warmen Licht des Weins zu verweilen, als sich in die beklemmenden Landschaften zu begeben.
Die Ballade ist somit eine Warnung vor der Angst und der Einsamkeit, die durch das Abdriften in eine Welt des Schreckens entstehen kann. Die lebendige Beschreibung der Horrorszenerie ist ein Mittel, um die Leser zu erschrecken und sie gleichzeitig dazu zu bewegen, sich der Schönheit und der Freude des Lebens zuzuwenden. Der Kontrast zwischen dem „finsteren Schein“ des Mondes und dem Vergnügen der Zecher deutet auf die Vorliebe des Autors für das Lebensgefühl, das in der Welt des Alkohols und der Freude erlangt werden kann, anstatt in einer dunklen, verlassenen Umgebung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.