Der sonnige Duft, Semptemberluft,
sie wehten ein Mücklein mir aufs Buch.
Das suchte sich die Ruhegruft
und fern vom Wald sein Leichentuch.
Vier Flügelein von Seiden fein
trug′s auf dem Rücken zart,
drin man im Regenbogenschein
spielendes Licht gewahrt!
Hellgrün das schlanke Leibchen war,
hellgrün der Füßchen dreifach Paar,
und auf dem Köpfchen wundersam
saß ein Federbüschchen stramm;
die Äuglein wie ein goldnes Erz
glänzten mir in das tiefste Herz.
Dies zierliche und manierliche Wesen
hatt′ sich zu Gruft und Leichentuch
das glänzende Papier erlesen,
darin ich las, ein dichterliches Buch;
so ließ den Band ich aufgeschlagen
und sah erstaunt dem Sterben zu,
wie langsam, langsam ohne Klagen
das Tierlein kam zu seiner Ruh.
Drei Tage ging es müd und matt
umher auf dem Papiere;
die Flügelein von Seide fein,
sie glänzten alle viere.
Am vierten Tage stand es still
gerade auf dem Wörtlein „will“!
Gar tapfer stand′s auf selbem Raum,
hob je ein Füßchen wie im Traum;
am fünften Tage legt′ es sich,
doch noch am sechsten regt′ es sich;
am siebten endlich siegt′ der Tod,
da war zu Ende seine Not.
Nun ruht im Buch sein leicht Gebein,
mög′ uns sein Frieden eigen sein!
Die kleine Passion
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
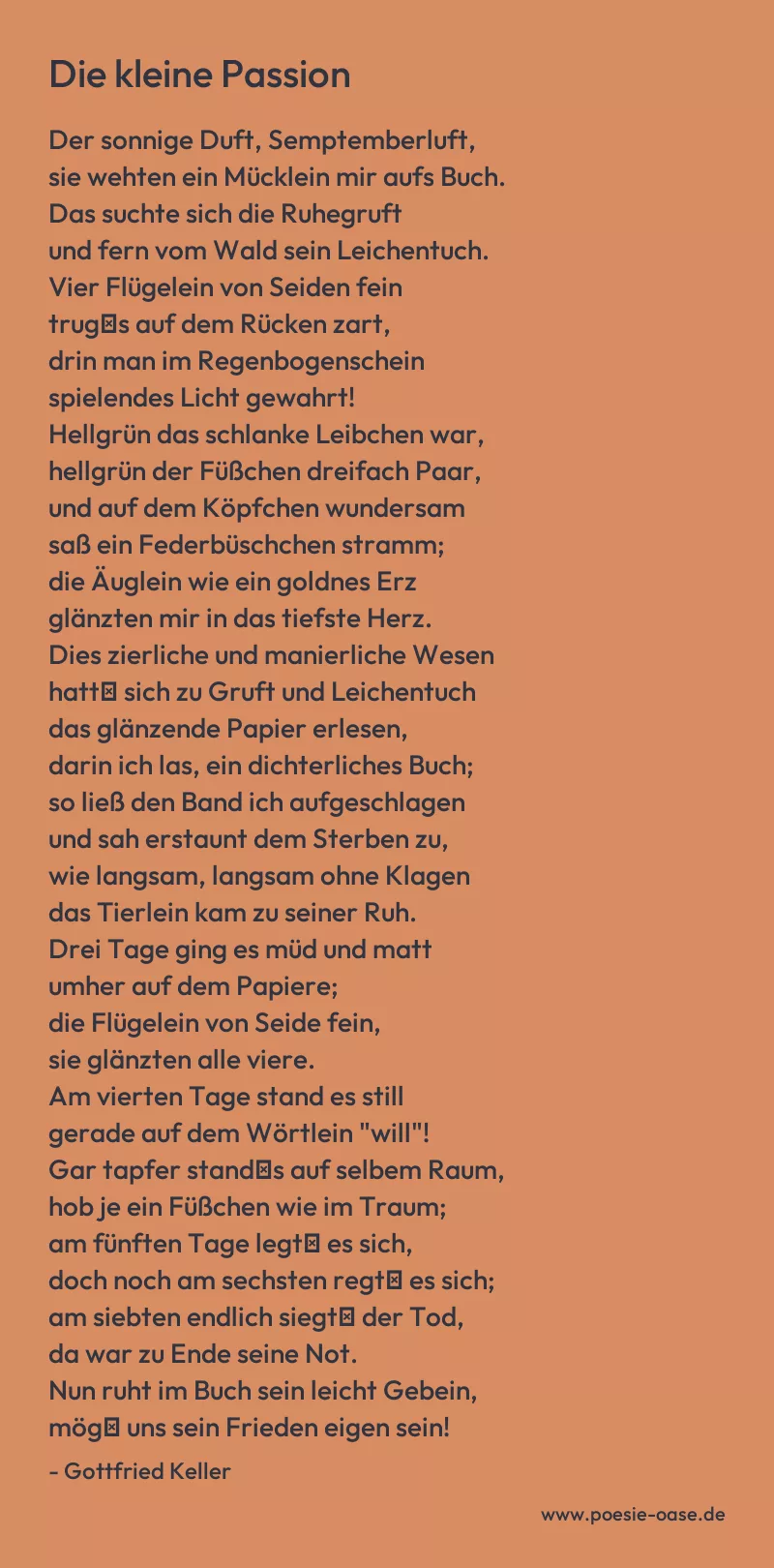
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die kleine Passion“ von Gottfried Keller ist eine zarte Betrachtung des Todes eines kleinen Insekts, vermutlich einer Mücke, und fungiert als eine Art Miniatur-Passion. Der Dichter beobachtet das Insekt, das sich auf seinem Buch zur Ruhe begeben hat, und beschreibt detailliert dessen physische Merkmale, bevor er den langsamen Sterbeprozess minutiös verfolgt. Die Verwendung des Wortes „Passion“ im Titel deutet darauf hin, dass das Gedicht über die bloße Beobachtung hinausgeht und eine tiefere, möglicherweise religiös konnotierte Ebene erreicht. Das sterbende Insekt wird als ein Symbol für die Vergänglichkeit und die Akzeptanz des Todes dargestellt.
Die poetische Sprache Kellers ist sehr bildhaft und detailreich, was dem Gedicht eine besondere Intimität verleiht. Die Beschreibung des Insekts ist liebevoll und präzise, von den „Flügelein von Seiden fein“ über das „hellgrün[e] Leibchen“ bis hin zu den „Äuglein wie ein goldnes Erz“. Diese detaillierte Beobachtung erzeugt eine tiefe Empathie für das kleine Wesen und verstärkt die tragische Dimension seines Sterbens. Der Dichter scheint das Insekt nicht nur zu beobachten, sondern auch seine stille, fast meditative Hingabe an den Tod zu respektieren. Die Wahl des Wortes „passion“ verstärkt die spirituelle Note, indem es das Leiden und den Tod des Insekts mit dem Leiden Christi in Verbindung bringt.
Ein bemerkenswertes Element des Gedichts ist die Art und Weise, wie der Dichter die Zeitwahrnehmung manipuliert. Der Sterbeprozess des Insekts wird über mehrere Tage hinweg geschildert, wobei jeder Tag mit subtilen Veränderungen und Bewegungen dokumentiert wird. Diese langsame Entfaltung des Sterbens erzeugt eine Atmosphäre der Melancholie und der Kontemplation. Besonders eindrucksvoll ist der Moment, als das Insekt am vierten Tag auf dem Wort „will“ verharrt, was eine symbolische Bedeutung für das Akzeptieren des Schicksals suggeriert. Der Dichter verweilt bei diesem Detail, bevor das Insekt seinen Todesweg fortsetzt.
Die abschließenden Verse des Gedichts drücken eine tiefe Respekt und Verbundenheit mit dem verstorbenen Insekt aus. Der Wunsch, dass „sein Frieden“ dem Leser „eigen sein“ möge, deutet auf eine universelle Botschaft über die Sterblichkeit und die Suche nach innerem Frieden hin. Keller vermittelt eine tiefe Akzeptanz des Lebenszyklus und eine Ehrfurcht vor der Natur. Das Gedicht wird somit zu einer Meditation über die Vergänglichkeit, die Schönheit des Lebens und die Würde des Todes, die uns alle am Ende erwartet. Es ist eine kleine, aber feierliche Hommage an das Leben und den ewigen Kreislauf der Natur.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
