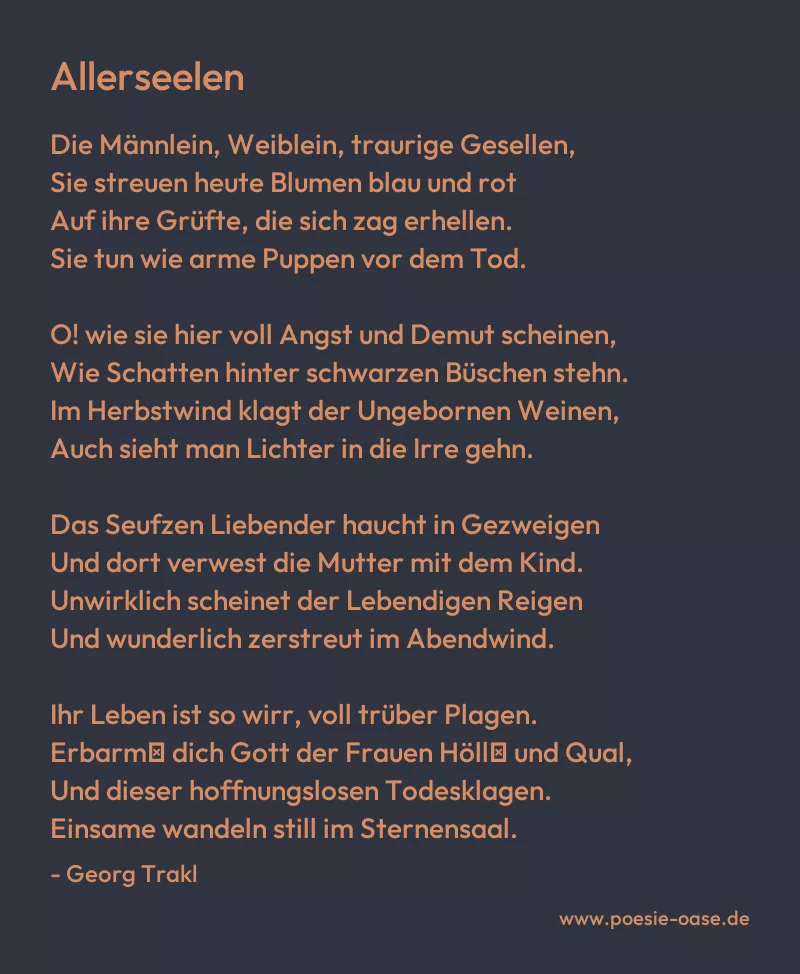Allerseelen
Die Männlein, Weiblein, traurige Gesellen,
Sie streuen heute Blumen blau und rot
Auf ihre Grüfte, die sich zag erhellen.
Sie tun wie arme Puppen vor dem Tod.
O! wie sie hier voll Angst und Demut scheinen,
Wie Schatten hinter schwarzen Büschen stehn.
Im Herbstwind klagt der Ungebornen Weinen,
Auch sieht man Lichter in die Irre gehn.
Das Seufzen Liebender haucht in Gezweigen
Und dort verwest die Mutter mit dem Kind.
Unwirklich scheinet der Lebendigen Reigen
Und wunderlich zerstreut im Abendwind.
Ihr Leben ist so wirr, voll trüber Plagen.
Erbarm′ dich Gott der Frauen Höll′ und Qual,
Und dieser hoffnungslosen Todesklagen.
Einsame wandeln still im Sternensaal.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
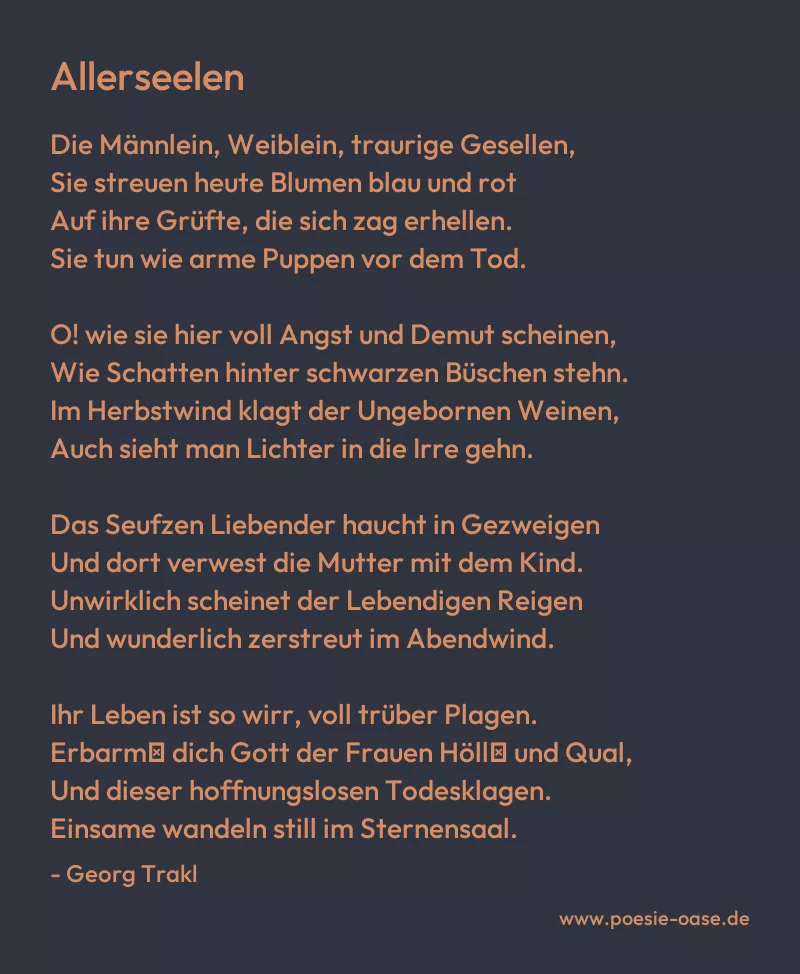
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Allerseelen“ von Georg Trakl ist eine düstere und melancholische Reflexion über Tod, Vergänglichkeit und das Leid der menschlichen Existenz. Der Titel, der sich auf den katholischen Gedenktag für die Verstorbenen bezieht, setzt den Rahmen für eine Betrachtung der Seelen, die sowohl in der Erinnerung der Lebenden als auch in der eigenen Existenz dem Tod nahe sind. Die Sprache ist von einer beklemmenden Atmosphäre und von Bildern geprägt, die die Angst und die Hoffnungslosigkeit der menschlichen Erfahrung verdeutlichen.
In den ersten beiden Strophen wird eine Szenerie der Trauer und des Gedenkens aufgebaut. Die „Männlein, Weiblein, traurige Gesellen“ sind die Lebenden, die am Allerseelentag die Gräber mit Blumen schmücken. Diese Geste der Verehrung und des Gedenkens wird jedoch von einer beklemmenden Atmosphäre der Angst und Demut begleitet, die durch die „Schatten hinter schwarzen Büschen“ symbolisiert wird. Das „Weinen der Ungeborenen“ im Herbstwind deutet auf eine Verbindung von Leben und Tod, von Geburt und Vergehen, und verstärkt das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Die „Lichter, die in die Irre gehen“, können als Sinnbilder für Seelen verstanden werden, die sich in der Dunkelheit verirren oder als Zeichen der Vergänglichkeit menschlicher Träume und Hoffnungen.
Die dritte Strophe vertieft die Thematik der Vergänglichkeit durch Bilder der Liebe und des Todes. Das „Seufzen Liebender“ in den Zweigen und die „Mutter mit dem Kind“, die „verwest“, stehen für die Auflösung von Beziehungen und die natürliche Auflösung des Lebens. Der „Lebendigen Reigen“, der „unwirklich“ scheint, weist auf die Flüchtigkeit des Lebens hin, während der Abendwind die Auflösung und das Zerstreuen des Lebensgefühls betont.
In der letzten Strophe werden die Motive des Leids und der Hoffnungslosigkeit weiter verstärkt. Das Leben wird als „wirr, voll trüber Plagen“ beschrieben, und der Dichter fleht um Erbarmen für die Frauen, die in der „Höll‘ und Qual“ gefangen sind. Die „hoffnungslosen Todesklagen“ unterstreichen das Gefühl der Verzweiflung und des Verlustes. Die „Einsamen“, die „still im Sternensaal wandeln“, können als die Toten oder als die Trauernden gesehen werden, die in einer Welt der Einsamkeit und der Stille zurückgelassen wurden. Das Gedicht endet mit einem Bild der Isolation, das die allgemeine Melancholie und Trauer noch verstärkt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.