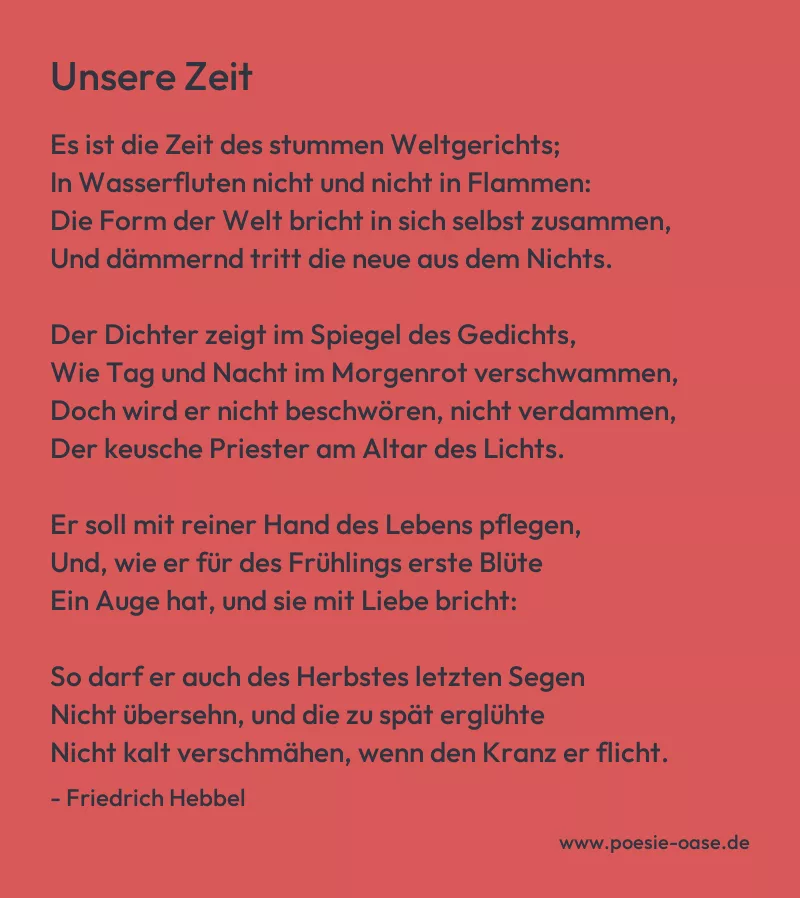Unsere Zeit
Es ist die Zeit des stummen Weltgerichts;
In Wasserfluten nicht und nicht in Flammen:
Die Form der Welt bricht in sich selbst zusammen,
Und dämmernd tritt die neue aus dem Nichts.
Der Dichter zeigt im Spiegel des Gedichts,
Wie Tag und Nacht im Morgenrot verschwammen,
Doch wird er nicht beschwören, nicht verdammen,
Der keusche Priester am Altar des Lichts.
Er soll mit reiner Hand des Lebens pflegen,
Und, wie er für des Frühlings erste Blüte
Ein Auge hat, und sie mit Liebe bricht:
So darf er auch des Herbstes letzten Segen
Nicht übersehn, und die zu spät erglühte
Nicht kalt verschmähen, wenn den Kranz er flicht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
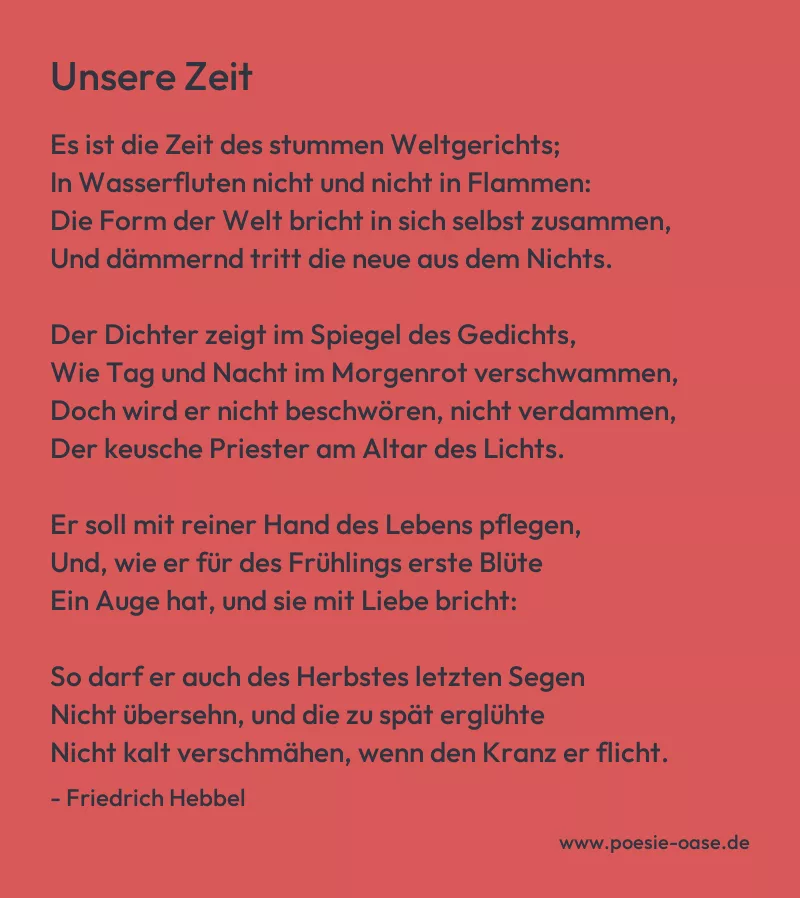
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Unsere Zeit“ von Friedrich Hebbel beschreibt eine Epoche des Wandels und der Transformation, die durch einen stillen, aber tiefgreifenden Wandel gekennzeichnet ist. Die Eröffnungszeile, „Es ist die Zeit des stummen Weltgerichts“, deutet auf eine Zeit der Erneuerung hin, die nicht durch äußere Katastrophen wie Wasserfluten oder Flammen, sondern durch einen inneren Zusammenbruch der alten Strukturen gekennzeichnet ist. Dieser „stumme“ Wandel impliziert eine schleichende, unaufhaltsame Veränderung, die die bestehende Ordnung in Frage stellt.
Die zentrale Metapher für diesen Wandel ist der Übergang von Tag zu Nacht und dann zum Morgenrot, der die Verschmelzung von Altem und Neuem symbolisiert. Der Dichter wird als „keuscher Priester am Altar des Lichts“ dargestellt, was seine Rolle als Beobachter und Verkünder der neuen Zeit hervorhebt. Er ist nicht dazu berufen, zu verurteilen oder zu verdammen, sondern die Veränderungen in ihrer Gesamtheit zu erfassen und widerzuspiegeln. Diese Haltung der Akzeptanz und des Verständnisses unterstreicht Hebbels humanistische Sichtweise.
Die zweite Strophe betont die Rolle des Dichters als Hüter des Lebens und seiner Vielfalt. Er soll „mit reiner Hand des Lebens pflegen“ und sowohl die „erste Blüte“ des Frühlings als auch den „letzten Segen“ des Herbstes wertschätzen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, alle Phasen des Lebens und der Natur anzunehmen, auch die, die dem Ende oder der Vergänglichkeit zugeordnet sind.
Die abschließenden Verse veranschaulichen diese Akzeptanz durch die Metapher des Kranzflechtens, bei dem sowohl die frühe Blüte als auch die „zu spät erglühte“ Blüte berücksichtigt werden. Der Dichter soll nichts verschmähen, sondern alles, was die Natur und die Zeit hervorbringen, in seine Kunst integrieren. Das Gedicht plädiert somit für eine umfassende Sichtweise, die den Wandel als integralen Bestandteil des Lebens begreift und die Fähigkeit des Dichters zur Beobachtung, Akzeptanz und künstlerischen Gestaltung hervorhebt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.