Faselst du? Dies Pasquill verleumdet die nobelsten Helden,
Wie es der rohste Poet nie noch vermeßner gewagt,
Äschylos nicht einmal, der doch der Prinzessin von Troja
Bilder vom Stier und der Kuh legt in den sittigen Mund.
Nein, wir kennen sie besser, die edlen Burgunder, und willst du
Reine Geschichte, so leih unserm Tragöden das Ohr.
Wie er den Lindwurm gänzlich beseitigt, weil Raff ihn nicht kannte
Und auch Cuvier nicht seine Gebeine entdeckt,
Also hat er zugleich die Recken des Eisens entkleidet,
Und sie zu Menschen gemacht, wie wir sie lieben bei uns.
Hagen wütet nicht blind, er ist ein besonnener Hofmann,
Der den Rivalen ersticht, weil er die Gnade ihm stiehlt,
Siegfried selber ist nichts, doch büßt er das schwere Verbrechen,
Daß er sich doppelt verlobt, was die Moral nicht erlaubt,
Kriemhild verbessert die Reden der Thekla und macht sie prosodisch,
Denn im Metrischen war Schiller bekanntlich ein Kind;
Brunhild allein blieb wild, und Gunther muß ringen und springen,
Aber es wird uns erklärt: weil sie die Mutter verlor!
Dennoch stört es ein wenig, und wenn der Dichter auch glücklich
Sich der Kappe des Zwergs, welche den Helfer verbarg,
Durch das natürliche Mittel der simplen Verkleidung erledigt,
Menschlicher wär′ es vielleicht, spielten die beiden nur Schach!
Tilg′ er denn unverweilt in souveräner Verachtung,
Wie das übrige, auch diesen barbarischen Rest!
Einsprache aus München
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
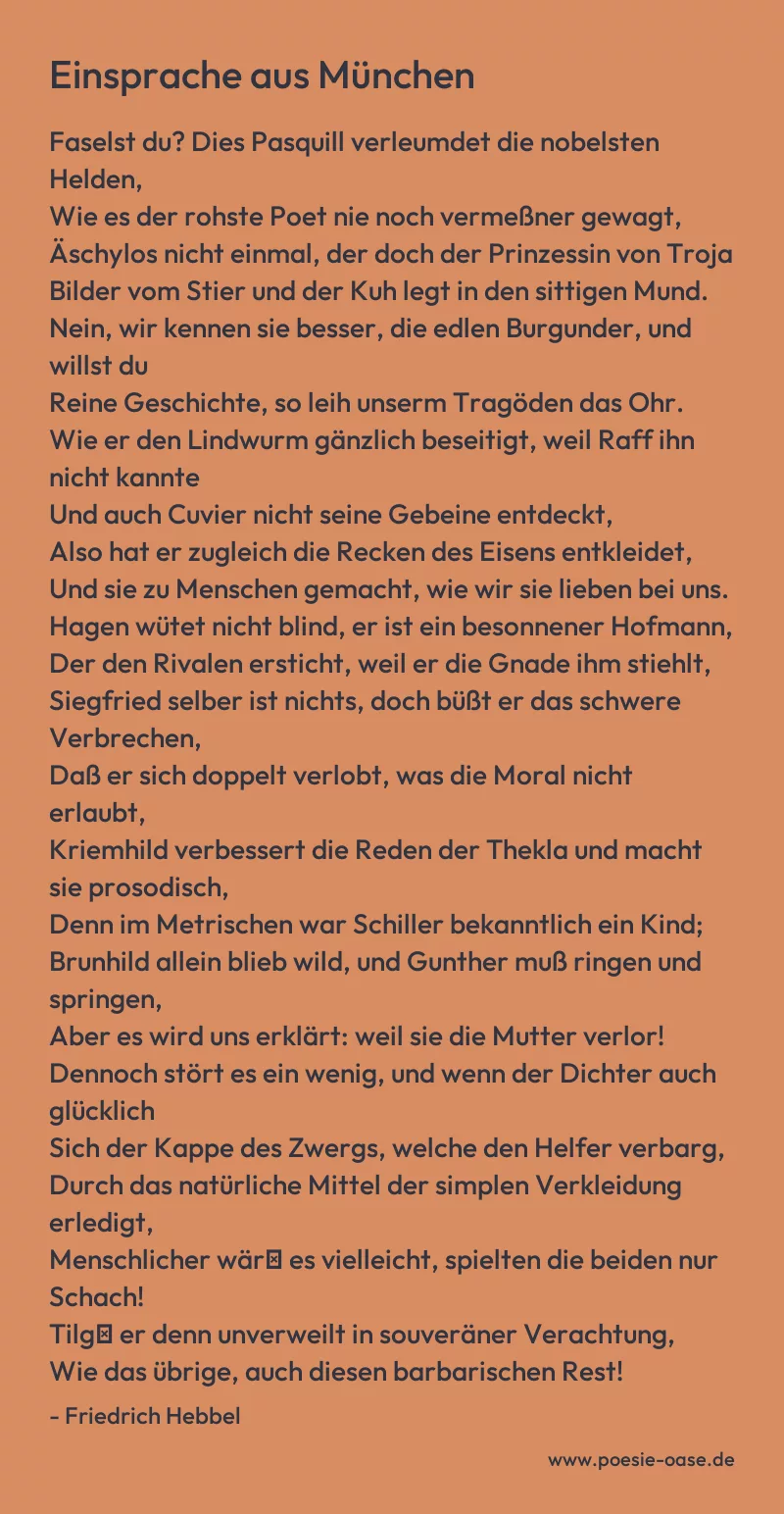
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Einsprache aus München“ von Friedrich Hebbel ist eine humorvolle und satirische Kritik an einer spezifischen, vermutlich zeitgenössischen Bearbeitung des Nibelungenlieds. Die ersten Verse etablieren sofort einen Ton der Überraschung und des Unglaubens über die Art und Weise, wie die klassischen Helden des Epos in der besagten Bearbeitung dargestellt werden. Der Dichter vergleicht die Frechheit der Darstellung mit der Kühnheit antiker Dramatiker wie Äschylos und kritisiert die Entstellung der Figuren, die in der neuen Version als verfälscht und verharmlost erscheinen.
Die zentrale Kritik richtet sich auf die „Vermenschlichung“ der Helden. Die Verse, in denen die traditionellen Figuren Hagen, Siegfried, Kriemhild, Brunhild und Gunther vorkommen, offenbaren die Ironie des Sprechers. Er bemängelt, dass die ursprüngliche Wildheit, das Unberechenbare und die tragische Größe der Figuren durch eine bürgerliche Moral ersetzt wurden. Hagen wird zu einem „besonnenen Hofmann“, Siegfried büßt für einen moralischen Fehler, und Kriemhild verbessert sogar die Reden Theklas, offenbar, um sie an die Konventionen der neuen Bearbeitung anzupassen. Diese „Verbesserungen“ werden mit spöttischer Distanz betrachtet.
Ein weiteres Element der Satire ist die Kritik an den dramaturgischen Mitteln und den Erklärungen, die in der Bearbeitung verwendet werden. Die Verse über Brunhilds „Wildheit“, die mit dem Verlust ihrer Mutter begründet wird, spiegeln eine Tendenz wider, komplexe Charaktere auf einfache psychologische Erklärungen zu reduzieren. Der Kommentar über die „Kappe des Zwergs“ und die Art und Weise, wie der Dichter dieses Problem löst, verdeutlicht die Absurdität und Künstlichkeit der neuen Darstellung. Der Sprecher schlägt am Ende sarkastisch vor, die gesamte Bearbeitung zu „tilgen“, um ihren „barbarischen Rest“ zu eliminieren und eine reinere, unverfälschte Version zu bewahren.
Der Humor des Gedichts resultiert aus der Diskrepanz zwischen der Erwartung des Lesers an die monumentale Tragik des Nibelungenlieds und der banalen, vereinfachten Darstellung, die kritisiert wird. Hebbels Sprache ist präzise und ironisch, wobei er klassische literarische Anspielungen nutzt, um die Überheblichkeit der neuen Bearbeitung aufzuzeigen. Das Gedicht ist ein Zeugnis für Hebbels literarische Meisterschaft und sein Verständnis für die Bedeutung von Tradition und literarischer Authentizität. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Kunst der Satire und die Fähigkeit, durch Ironie und Spott eine tiefgreifende Kritik an kulturellen Entwicklungen auszuüben.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
