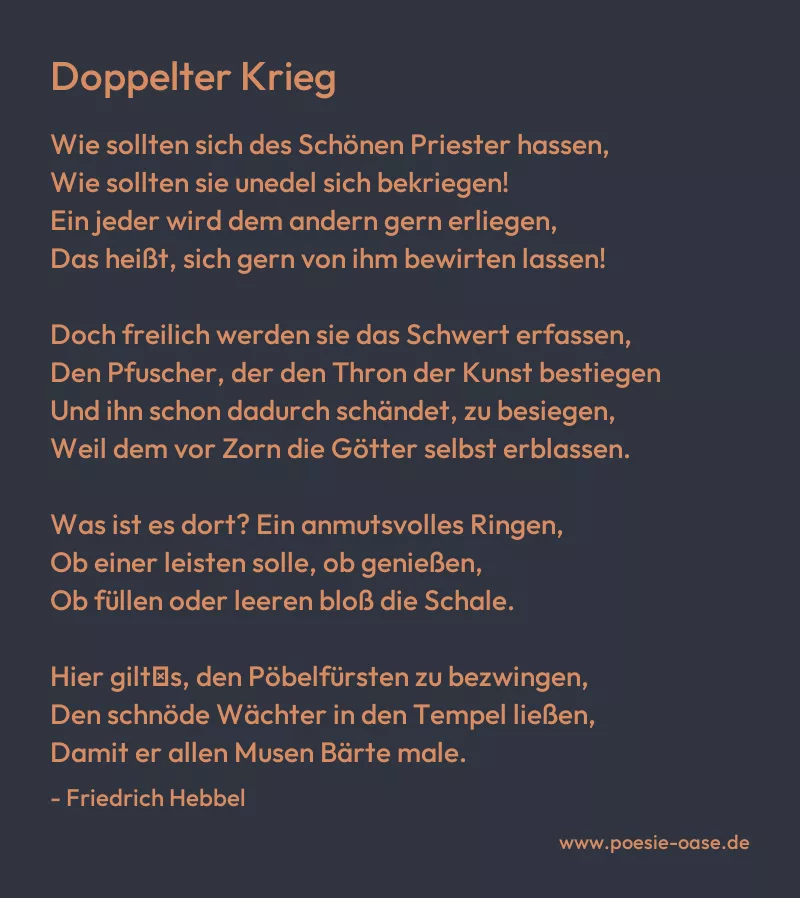Doppelter Krieg
Wie sollten sich des Schönen Priester hassen,
Wie sollten sie unedel sich bekriegen!
Ein jeder wird dem andern gern erliegen,
Das heißt, sich gern von ihm bewirten lassen!
Doch freilich werden sie das Schwert erfassen,
Den Pfuscher, der den Thron der Kunst bestiegen
Und ihn schon dadurch schändet, zu besiegen,
Weil dem vor Zorn die Götter selbst erblassen.
Was ist es dort? Ein anmutsvolles Ringen,
Ob einer leisten solle, ob genießen,
Ob füllen oder leeren bloß die Schale.
Hier gilt′s, den Pöbelfürsten zu bezwingen,
Den schnöde Wächter in den Tempel ließen,
Damit er allen Musen Bärte male.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
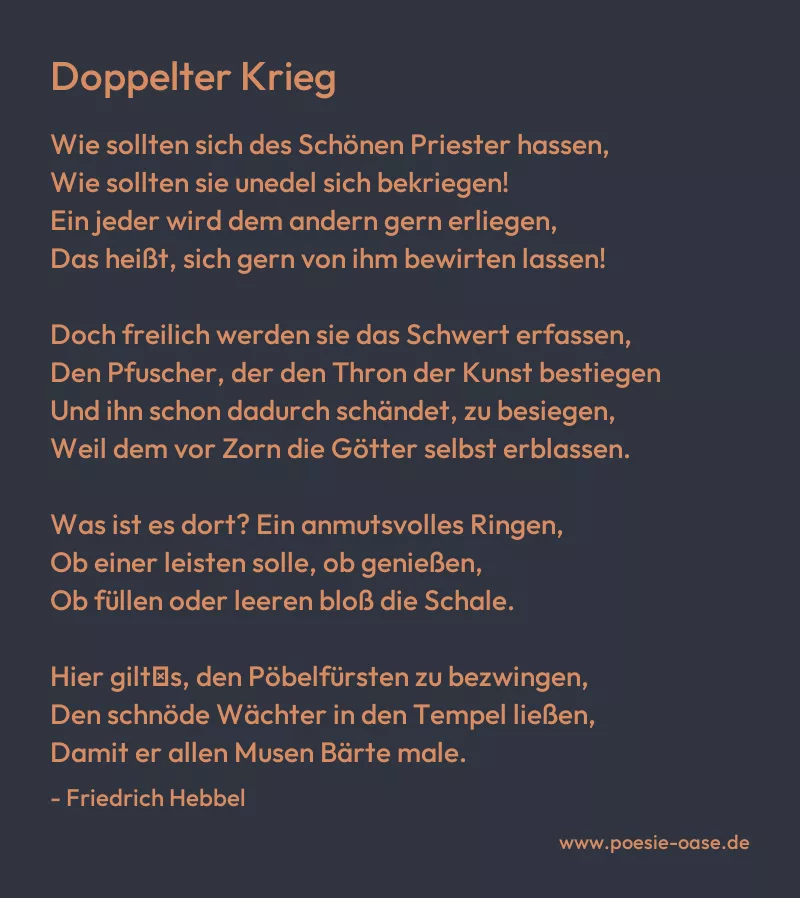
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Doppelter Krieg“ von Friedrich Hebbel beschäftigt sich mit den Spannungen innerhalb der Kunstwelt, insbesondere mit der Rivalität zwischen Künstlern und der Bedrohung durch falsche oder minderwertige Kunst. Das Sonett beginnt mit einer fast ironischen Beobachtung: Diejenigen, die eigentlich das Schöne verehren sollten, bekriegen sich auf eine Weise, die mehr nach gegenseitigem Vorteil als nach echtem Kampf aussieht. Sie scheinen sich im Grunde genommen zu „bewirten“ – also zu unterstützen und voneinander zu profitieren – anstatt sich wirklich zu bekämpfen. Dies deutet auf eine gewisse Verlogenheit und Selbstgefälligkeit in der Szene hin.
Die zweite Strophe schwenkt in eine ernsthaftere Tonlage um. Hier wird die echte Bedrohung für die Kunst thematisiert: der „Pfuscher“, der den Thron der Kunst „bestiegen“ hat. Dieser Begriff deutet auf jemanden hin, der die Kunst nicht verdient hat und sie durch seine Anwesenheit entehrt. Die „Götter selbst“ erblassen vor Zorn, was die Schwere der Situation unterstreicht. Diese Verse drücken die Angst vor dem Niedergang der Kunst durch mangelhafte Qualität und die Notwendigkeit, sich gegen solche Kräfte zu wehren, aus.
Die dritte Strophe, die mit einem rhetorischen Frage beginnt, verlagert den Fokus auf eine tiefergehende Auseinandersetzung innerhalb der Kunst: das Spannungsfeld zwischen „leisten“ und „genießen“, zwischen Schaffen und Konsum, zwischen dem Füllen und Leeren der „Schale“. Dies deutet auf die Schwierigkeit hin, in der Kunstwelt einen Balanceakt zwischen dem Schaffen von Kunst und dem Empfang von Kunst zu finden. Künstler müssen nicht nur erschaffen, sondern auch das Publikum erreichen und bewegen.
Die abschließende Strophe verlagert das Geschehen auf eine politische Ebene. Es geht darum, den „Pöbelfürsten“, also das vulgäre Publikum, zu bezwingen, sowie die „schnöden Wächter“, die den Zugang zu den Musen, also zur Kunst, freigeben. Dies verdeutlicht, dass die wahre Bedrohung für die Kunst nicht nur von innen, sondern auch von außen droht. Diese Zeilen kritisieren die Kommerzialisierung und Popularisierung der Kunst, die dazu führen kann, dass minderwertige Werke gefördert werden, wenn sie den Geschmack der Masse bedienen. Hebbel fordert somit einen Kampf gegen alle Kräfte, die die Reinheit und Qualität der Kunst gefährden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.