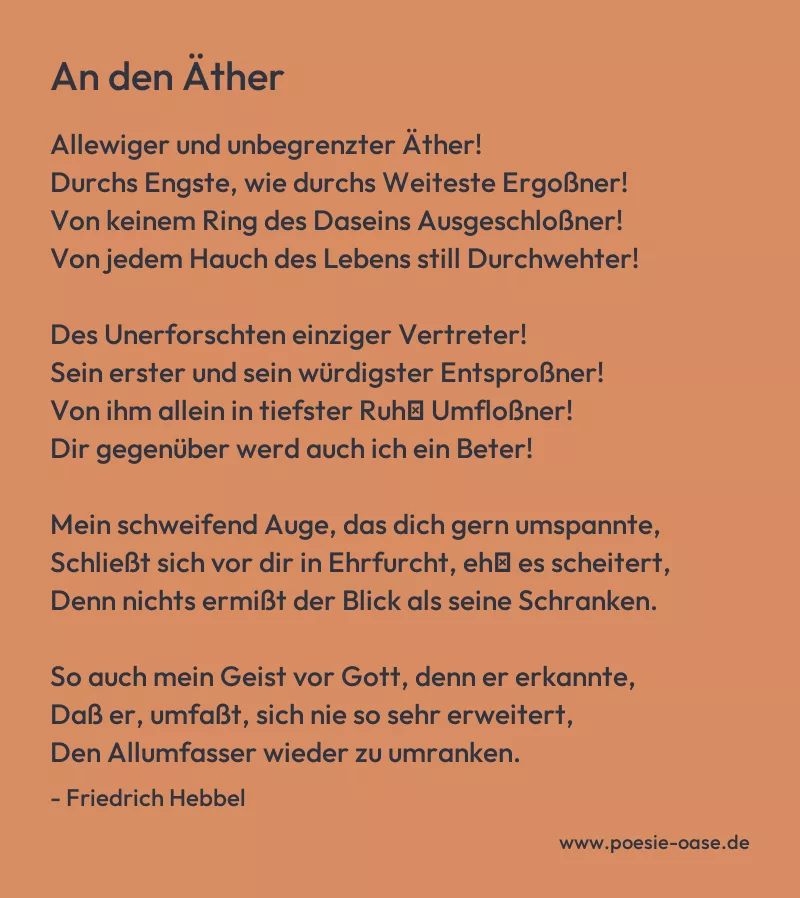An den Äther
Allewiger und unbegrenzter Äther!
Durchs Engste, wie durchs Weiteste Ergoßner!
Von keinem Ring des Daseins Ausgeschloßner!
Von jedem Hauch des Lebens still Durchwehter!
Des Unerforschten einziger Vertreter!
Sein erster und sein würdigster Entsproßner!
Von ihm allein in tiefster Ruh′ Umfloßner!
Dir gegenüber werd auch ich ein Beter!
Mein schweifend Auge, das dich gern umspannte,
Schließt sich vor dir in Ehrfurcht, eh′ es scheitert,
Denn nichts ermißt der Blick als seine Schranken.
So auch mein Geist vor Gott, denn er erkannte,
Daß er, umfaßt, sich nie so sehr erweitert,
Den Allumfasser wieder zu umranken.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
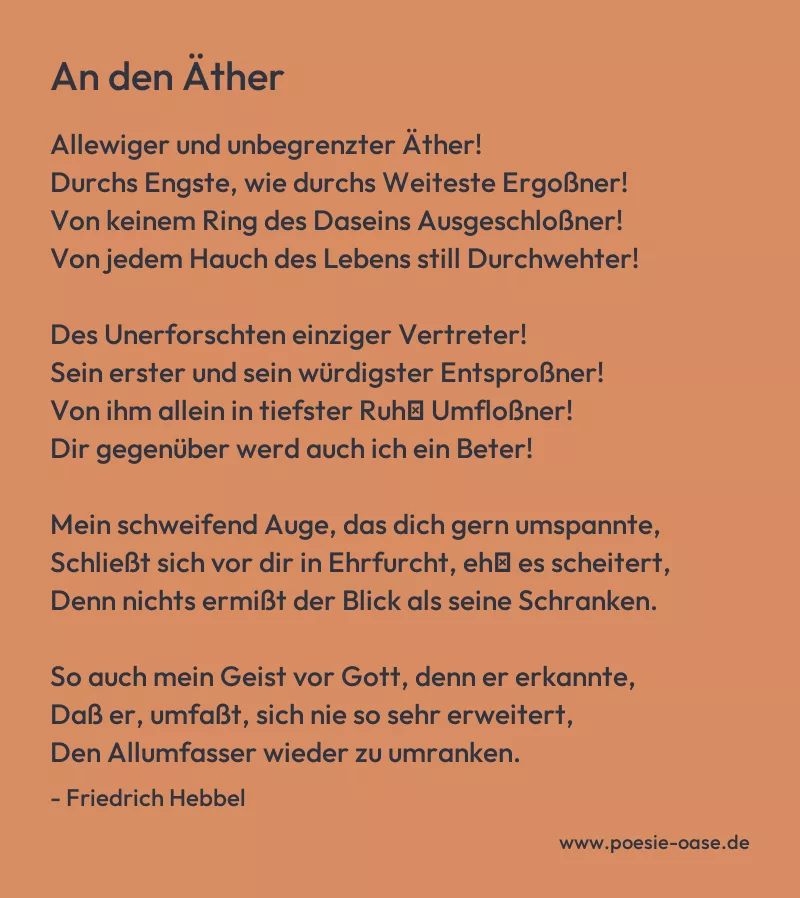
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den Äther“ von Friedrich Hebbel ist eine ergreifende Hymne, die die Erhabenheit und Unendlichkeit des Äthers preist, während sie gleichzeitig die Begrenztheit des menschlichen Verständnisses betont. Hebbel wählt den Äther als Symbol für das Göttliche, das Unbegreifliche und Allumfassende, das sich durch alle Bereiche des Daseins erstreckt. Das Gedicht beginnt mit einer Anrufung des Äthers, die seine Eigenschaften wie Unbegrenztheit, Allgegenwart und seine Fähigkeit, das Leben sanft zu durchwehen, hervorhebt.
In den folgenden Strophen wird die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und dem Äther beleuchtet. Das Ich, das versucht, den Äther mit seinem Blick zu erfassen, muss erkennen, dass es letztendlich an seine eigenen Grenzen stößt. Das Auge scheitert, weil es nur seine eigenen Schranken ermessen kann. Diese Erkenntnis führt zu Ehrfurcht und Demut, die das lyrische Ich dazu veranlassen, sich vor dem Äther zu schließen, symbolisch für die Aufgabe, das Unendliche mit dem begrenzten Verstand zu begreifen.
Die dritte Strophe verdeutlicht die Analogie zwischen der Beziehung des lyrischen Ichs zum Äther und der Beziehung des Geistes zu Gott. Der Geist erkennt, dass er in seiner umfassenden Umarmung durch Gott nicht nur begrenzt, sondern in Wahrheit erweitert wird. Dies spiegelt die paradoxe Erkenntnis wider, dass wir uns am meisten entwickeln, wenn wir uns dem Unbegreiflichen ergeben. Die Formulierung „Den Allumfasser wieder zu umranken“ deutet auf eine tiefe Sehnsucht des Menschen nach der Einheit mit dem Absoluten hin, obwohl die Grenzen des menschlichen Verstandes diese Einheit letztlich unerreichbar machen.
Hebbel nutzt eine feierliche, erhabene Sprache, um die Größe des Themas zu unterstreichen. Die Verwendung von Adjektiven wie „unbegrenzter“, „unerforschter“ und „allumfassender“ sowie die Anordnung der Verse in einem Sonett unterstreichen die Ernsthaftigkeit und den philosophischen Anspruch des Gedichts. Es ist eine Meditation über die Grenzen des menschlichen Denkens, die Unendlichkeit des Göttlichen und die paradoxe Natur der menschlichen Erfahrung – ein Versuch, das Unergründliche durch Sprache zu umfassen, obwohl die Erkenntnis der eigenen Begrenztheit im Vordergrund steht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.