Ja, das ist meines lieben Victor Antlitz!
Schlicht, treu und fest und deutsch in Ernst und Scherz:
So blickte er, wann er zu Radolfszell,
Erfreut, bewegt, der Jugendzeit gedenk,
Mich in die Arme schloß und zur »Seehalde«
Den grünen Angerpfad hinan mich führte! –
Den schau′ Dir an, Du theure deutsche Jugend,
Und dank′ ihm immerdar, daß er Dir reichte
Aus deutscher Vorzeit quellbornfrischen Trank:
Denn, was frivol, krank, süßlich und salonhaft,
War ihm verhaßt: ein treuer Eckhard war er:
Ihn sollt Ihr werth und hoch und theuer halten,
So lang′ in Wolken ragt der Hohentwiel,
Frau Aventiure auf den Straßen geistert,
So lang′ des Alamannenlands Saphir,
Der Bodensee, noch glänzt in lichter Bläue,
So lang′ noch deutscher Dichtung Wort ertönt:
Mit ihm vergleiche keiner sich, der lebt,
Und keiner seinesgleichen kehrt uns wieder!
Zum Bilde Scheffels
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
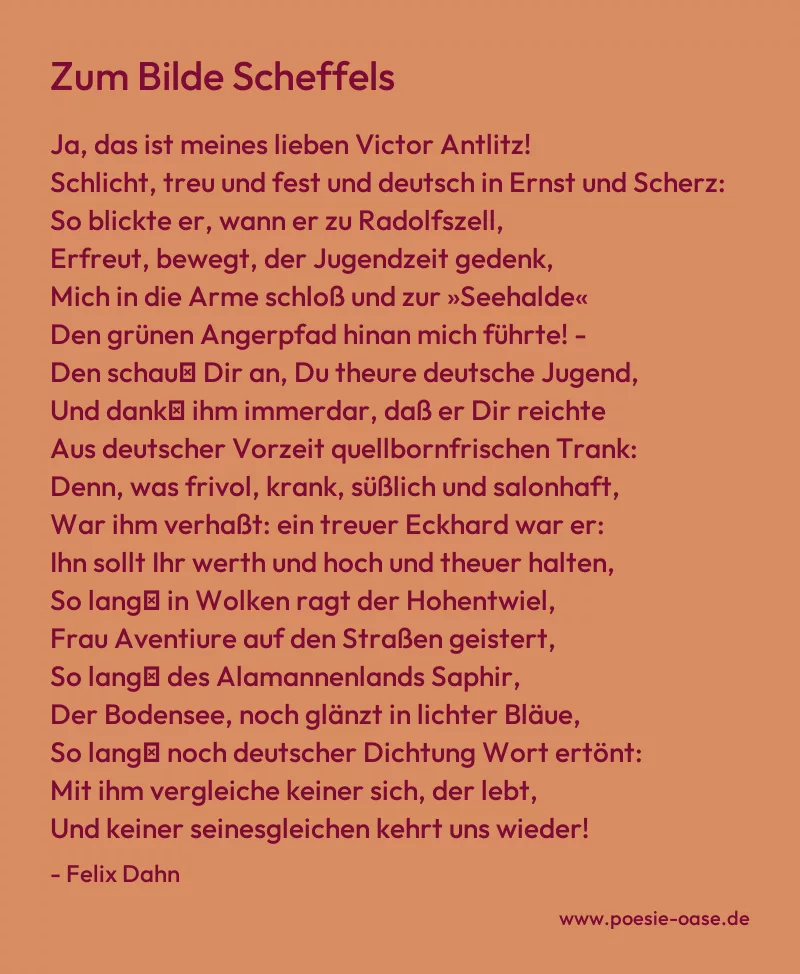
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zum Bilde Scheffels“ von Felix Dahn ist eine Huldigung an den Schriftsteller Victor von Scheffel, eine zentrale Figur des deutschsprachigen Kulturlebens im 19. Jahrhundert. Es ist eine Art Lobgesang, der Scheffels Tugenden und Verdienste hervorhebt und gleichzeitig einen Appell an die deutsche Jugend richtet, Scheffel als Vorbild zu ehren und zu bewahren. Das Gedicht ist geprägt von einer pathetischen, geradezu hymnischen Sprache, die Scheffel als einen Inbegriff deutsch-nationaler Werte stilisiert.
Dahn beschreibt zunächst Scheffels äußere Erscheinung als „schlicht, treu und fest und deutsch“, wobei er dessen Wesen mit Charakterzügen wie Ehrlichkeit, Loyalität und deutscher Identität verbindet. Die Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse in Radolfszell, wo Scheffel Dahn „in die Arme schloß“, erzeugt eine persönliche Note, die das Gedicht authentischer wirken lässt. Die anschließende Aufforderung an die „theure deutsche Jugend“, Scheffel anzuschauen und ihm zu danken, etabliert eine Verbindung zwischen dem Dichter und der kommenden Generation, die Scheffels Werk und Ideale weitertragen soll.
Der Kern der Botschaft liegt in der Gegenüberstellung von Scheffels Werk und Geist zu allem, was Dahn als „frivol, krank, süßlich und salonhaft“ ablehnt. Scheffel wird als „treuer Eckhard“ charakterisiert, ein Begriff, der auf die Treue und Beständigkeit des mittelalterlichen Sagenhelden Eckhard Bezug nimmt. Diese Gegenüberstellung impliziert eine klare Abgrenzung von dekadenten oder ausländischen Einflüssen und eine Betonung der Bedeutung von Tradition, Authentizität und deutscher Identität. Die Aufzählung von Natur- und Kulturdenkmälern wie dem Hohentwiel, der Aventiure und dem Bodensee unterstreicht die Verbindung von Scheffels Werk mit der deutschen Landschaft und Geschichte.
Das Gedicht ist ein typisches Beispiel für die patriotische Dichtkunst des 19. Jahrhunderts. Es verherrlicht die Vergangenheit, feiert die deutsche Kultur und ruft zur Treue zu den nationalen Werten auf. Die sprachliche Gestaltung mit ihren emphatischen Formulierungen und der Verwendung von Begriffen wie „theuer“ und „wert“ verstärkt den feierlichen Charakter des Gedichts. Der letzte Vers „Mit ihm vergleiche keiner sich, der lebt, / Und keiner seinesgleichen kehrt uns wieder!“ unterstreicht die Einzigartigkeit Scheffels und bekräftigt dessen herausragende Bedeutung für die deutsche Kultur.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
