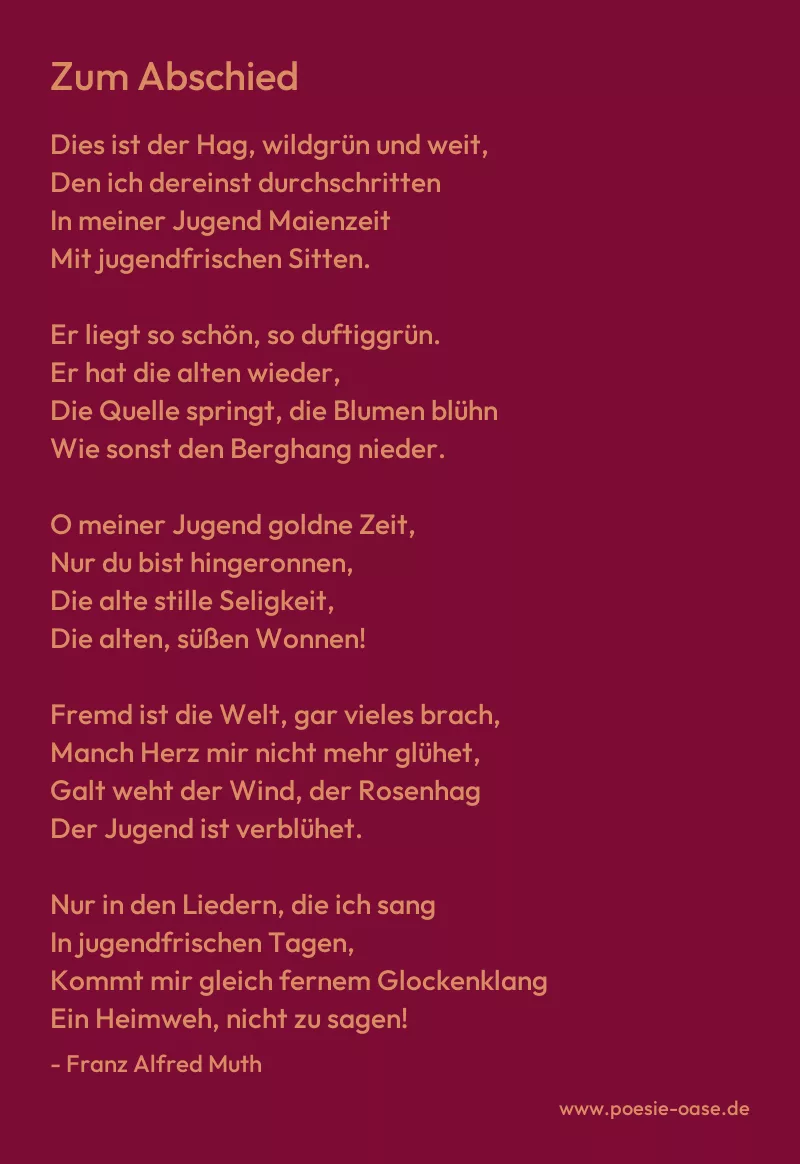Zum Abschied
Dies ist der Hag, wildgrün und weit,
Den ich dereinst durchschritten
In meiner Jugend Maienzeit
Mit jugendfrischen Sitten.
Er liegt so schön, so duftiggrün.
Er hat die alten wieder,
Die Quelle springt, die Blumen blühn
Wie sonst den Berghang nieder.
O meiner Jugend goldne Zeit,
Nur du bist hingeronnen,
Die alte stille Seligkeit,
Die alten, süßen Wonnen!
Fremd ist die Welt, gar vieles brach,
Manch Herz mir nicht mehr glühet,
Galt weht der Wind, der Rosenhag
Der Jugend ist verblühet.
Nur in den Liedern, die ich sang
In jugendfrischen Tagen,
Kommt mir gleich fernem Glockenklang
Ein Heimweh, nicht zu sagen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
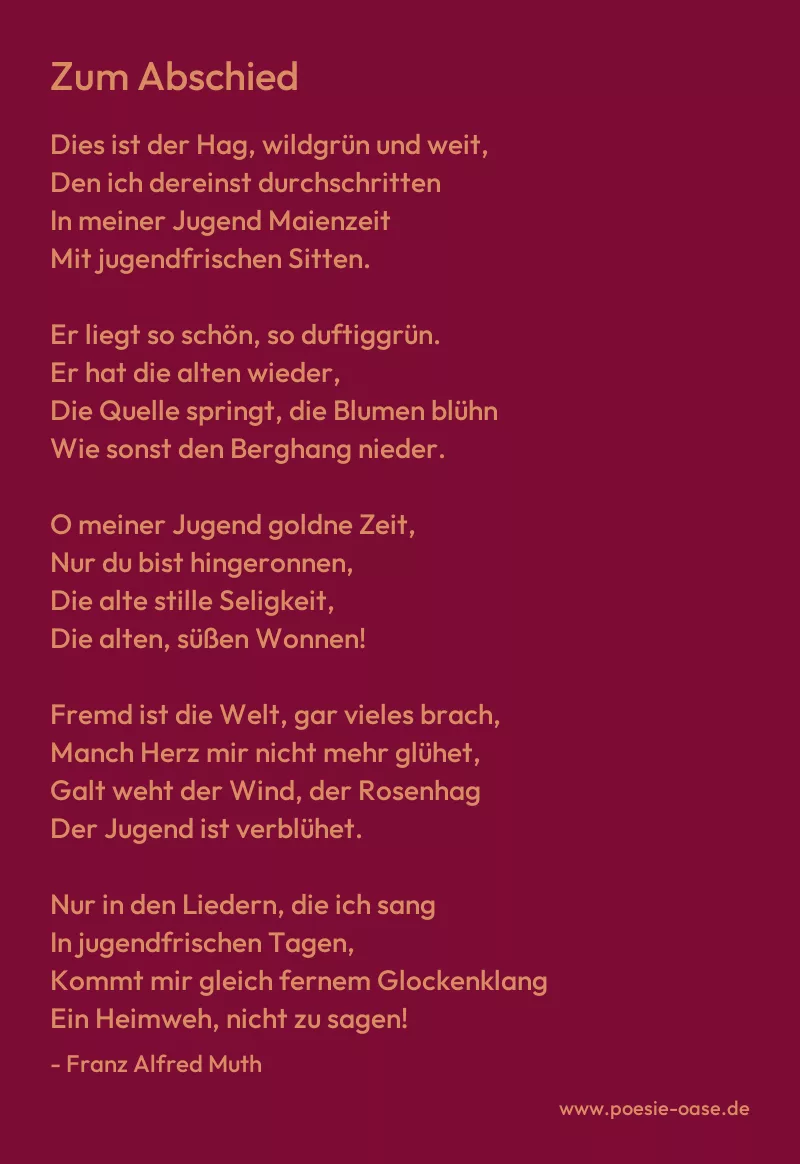
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zum Abschied“ von Franz Alfred Muth ist eine melancholische Reflexion über den Verlust der Jugend und die Vergänglichkeit der Zeit. Das lyrische Ich blickt auf einen Ort seiner Vergangenheit zurück, einen „Hag, wildgrün und weit“, und vergleicht die Erinnerung an die Jugend mit der Gegenwart. Die Natur, die sich scheinbar unversehrt präsentiert, dient als Kontrast zu den inneren Veränderungen des Erzählers. Die Quelle springt, die Blumen blühen – alles scheint wie früher, doch der Dichter empfindet eine tiefe Distanz und Fremdheit.
Der Dichter betont die „goldne Zeit“ der Jugend, die unwiederbringlich „hingeronnen“ ist. Diese Nostalgie wird durch die Beschreibung der „alten, süßen Wonnen“ verstärkt, die jedoch nur noch in der Erinnerung existieren. Die Welt hat sich verändert, viele Beziehungen sind zerbrochen, und die Lebendigkeit der Jugend ist verflogen. Das Gedicht zeugt von einem Gefühl des Verlustes und der Entfremdung, das durch die Gegenüberstellung der unveränderten Natur und den veränderten Empfindungen des lyrischen Ichs noch verstärkt wird.
Die Metapher des „Rosenhags“ der Jugend, der „verblüht“ ist, verdeutlicht den Verfall und die Vergänglichkeit der jugendlichen Unbeschwertheit und des Glücks. Der Wind, der „weht“, symbolisiert das Verstreichen der Zeit und die Abnahme der Lebenskraft. Die Verwendung von Adjektiven wie „fremd“ und „gar vieles brach“ unterstreicht die Distanz zur Gegenwart und die Sehnsucht nach der Vergangenheit.
Trost findet der Dichter in seinen Liedern, die er in seiner Jugend sang. Diese Lieder werden zum Ausdrucksmittel des Heimwehs, das „nicht zu sagen“ ist. Sie erinnern ihn an die „jugendfrischen Tage“ und bieten einen indirekten Kontakt zur verlorenen Welt. Das „fernem Glockenklang“ deutet die Erinnerungen an, die aus der Ferne erklingen und eine subtile, aber tiefe Sehnsucht auslösen. Das Gedicht endet somit mit einem bittersüßen Gefühl der Erinnerung und des Abschieds.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.