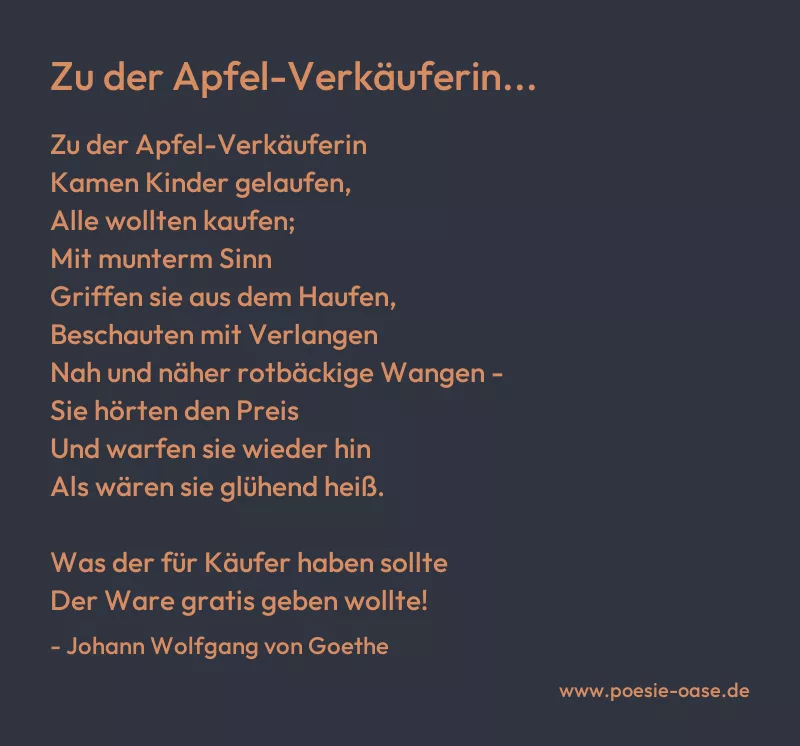Zu der Apfel-Verkäuferin…
Zu der Apfel-Verkäuferin
Kamen Kinder gelaufen,
Alle wollten kaufen;
Mit munterm Sinn
Griffen sie aus dem Haufen,
Beschauten mit Verlangen
Nah und näher rotbäckige Wangen –
Sie hörten den Preis
Und warfen sie wieder hin
Als wären sie glühend heiß.
Was der für Käufer haben sollte
Der Ware gratis geben wollte!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
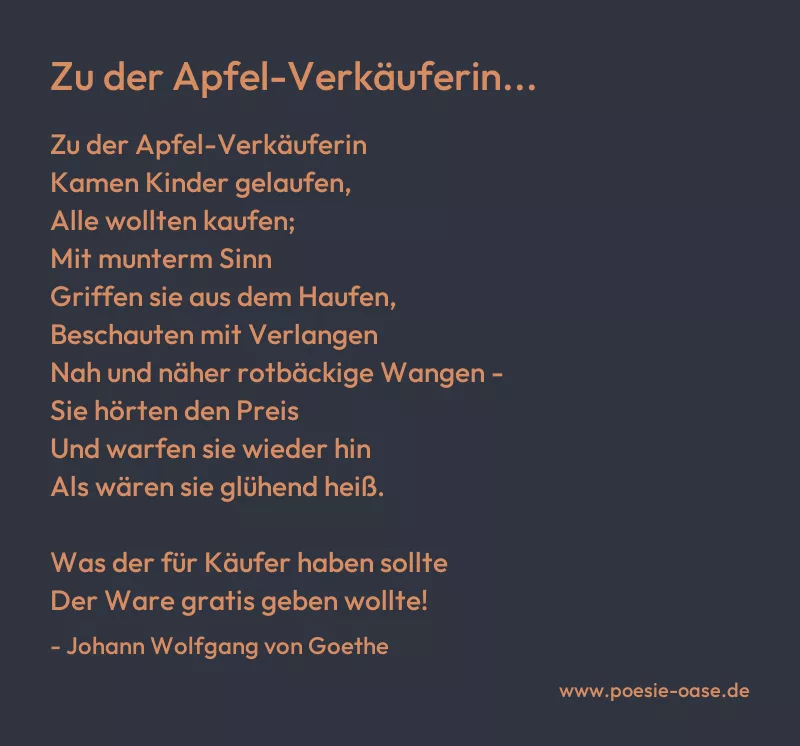
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zu der Apfel-Verkäuferin…“ von Johann Wolfgang von Goethe entfaltet in schlichten Worten eine kleine Szene, die sowohl die kindliche Begeisterung als auch die Ernüchterung durch den Preis einfängt. Die Kinder, angezogen von den roten Äpfeln, rennen zur Verkäuferin, ein Bild unbändiger Freude und Erwartung. Sie begutachten die Äpfel, betrachten die „rotbäckigen Wangen“, also die Äpfel, mit großer Aufmerksamkeit und „Verlangen“. Das Gedicht lebt von der Direktheit und Einfachheit der Sprache, die die kindliche Perspektive unmittelbar erlebbar macht.
Der Wendepunkt des Gedichts ist die Nennung des Preises. Der Enthusiasmus der Kinder verflüchtigt sich augenblicklich. Wie von glühender Hitze verbrannt, werfen sie die Äpfel wieder hin. Der Kontrast zwischen dem anfänglichen Verlangen und der anschließenden Ablehnung ist deutlich und humorvoll. Die Kinder müssen erkennen, dass ihre Wünsche durch finanzielle Hindernisse begrenzt sind. Der Gedichtaufbau verstärkt diesen Effekt, indem es die anfängliche Begeisterung über die Äpfel in den ersten Strophen schildert, bevor die bittere Realität der finanziellen Unerschwinglichkeit in den letzten Zeilen zutage tritt.
Die abschließende Frage des Gedichts, „Was der für Käufer haben sollte/Der Ware gratis geben wollte!“, wirft einen subtilen Kommentar auf die kindliche Denkweise und die Marktwirtschaft auf. Sie zeigt die naive Erwartung der Kinder, die davon ausgehen, dass die Verkäuferin ihnen die Äpfel schenken sollte. Diese Frage offenbart die Kluft zwischen Wunsch und Realität, zwischen dem Begehren nach den Äpfeln und der Erkenntnis, dass sie einen Preis haben. Der Text deutet spielerisch an, dass der Wunsch nach etwas, was unerschwinglich ist, letztlich unerfüllt bleiben muss.
Goethes Gedicht ist in seiner Kürze und Einfachheit von bemerkenswerter Prägnanz. Es fängt die kindliche Sehnsucht und die darauf folgende Enttäuschung auf humorvolle Weise ein und wirft zugleich einen unaufdringlichen Blick auf die ökonomischen Realitäten. Die Nutzung einfacher Reime und die Alltagssprache machen das Gedicht leicht zugänglich und tragen dazu bei, die Szene lebendig werden zu lassen. Es ist ein kleines, aber feines Beispiel für Goethes Fähigkeit, Alltägliches in literarischer Form zu erfassen und dabei sowohl die kindliche Freude als auch die Ernüchterung darzustellen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.