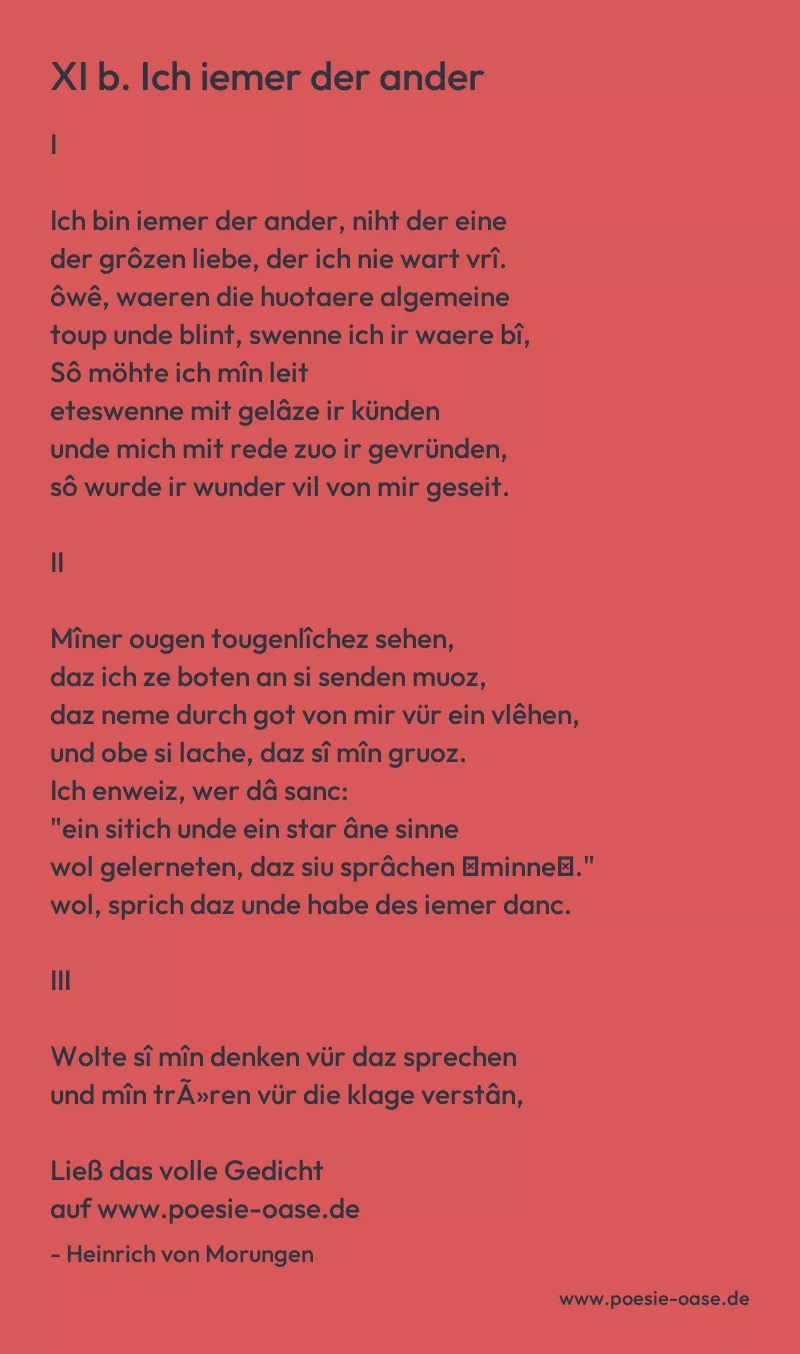XI b. Ich iemer der ander
I
Ich bin iemer der ander, niht der eine
der grôzen liebe, der ich nie wart vrî.
ôwê, waeren die huotaere algemeine
toup unde blint, swenne ich ir waere bî,
Sô möhte ich mîn leit
eteswenne mit gelâze ir künden
unde mich mit rede zuo ir gevründen,
sô wurde ir wunder vil von mir geseit.
II
Mîner ougen tougenlîchez sehen,
daz ich ze boten an si senden muoz,
daz neme durch got von mir vür ein vlêhen,
und obe si lache, daz sî mîn gruoz.
Ich enweiz, wer dâ sanc:
„ein sitich unde ein star âne sinne
wol gelerneten, daz siu sprâchen ′minne′.“
wol, sprich daz unde habe des iemer danc.
III
Wolte sî mîn denken vür daz sprechen
und mîn trûren vür die klage verstân,
sô müese in der niuwen rede gebrechen.
owê, daz iemen sol vür vuoge hân,
Daz er sêre klage,
daz er doch von herzen niht meinet,
alse einer trûret unde weinet
unde er sîn niemen kan gesagen.
IV
Sît siu herzeliebe heizent minne,
so enweiz ich niht, wie diu liebe heizen sol.
herzeliebe wont in mînem sinne.
liep hân ich gerne, leides enbaere ich wol.
Diu guote diu gît mir
hôhen muot, dar zuo vröide unde wunne.
sô enweiz ich, waz diu liebe kunne,
wan daz ich iemer trûren muoz nâch ir.
V
Sî ensol niht allen liuten lachen
alse von herzen, sam si lachet mir,
und ir ane sehen sô minneclîchen machen.
waz hât aber ieman daz ze schouwen an ir,
Der ich leben sol,
und an der ist al mîn wunne behalten?
joch enwil ich niemer des eralten,
swenne ich si sîhe, mir ensî von herzen wol.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
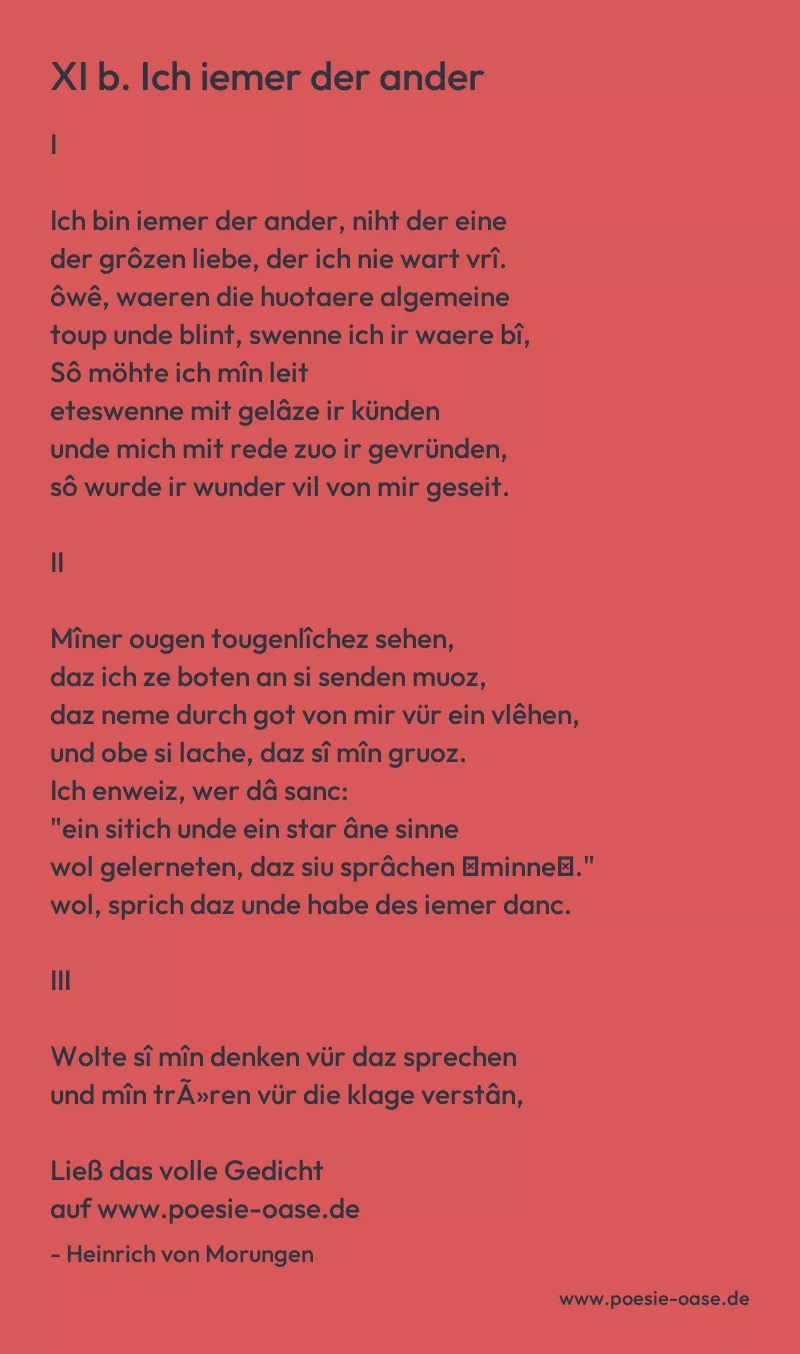
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „XI b. Ich iemer der ander“ von Heinrich von Morungen ist eine kunstvolle Auseinandersetzung mit den Qualen und Freuden unerwiderter Liebe im höfischen Kontext. Es offenbart die Zerrissenheit des lyrischen Ichs, das zwischen dem Wunsch nach Nähe und der Angst vor Zurückweisung schwankt. Die zentralen Themen sind die Unfähigkeit, die eigenen Gefühle offen zu äußern, die Sehnsucht nach der Geliebten und das Paradox der Liebe, die gleichzeitig Freude und Leid verursacht.
Der erste Teil des Gedichts (Strophe I) beginnt mit der Feststellung, dass das lyrische Ich „iemer der ander“ ist, also nicht derjenige, der die Liebe uneingeschränkt genießt. Die Sehnsucht nach der Geliebten ist so groß, dass der Sprecher sich wünscht, die Wachen der Geliebten wären taub und blind, sodass er ihr seine Gefühle mitteilen könnte. Das Schweigen, die Unfähigkeit, die eigenen Gefühle auszusprechen, ist ein zentrales Motiv. Die Liebe ist hier mit Leid verbunden, ein Gefühl, das sich durch das gesamte Gedicht zieht. Die folgenden Strophen thematisieren die Hoffnungslosigkeit, die das lyrische Ich in Bezug auf die Geliebte empfindet.
Die Strophen II und III thematisieren die indirekte Kommunikation und die daraus resultierende Sprachlosigkeit. Die Augen dienen als Boten der Gefühle, während Worte versagen. Das lyrische Ich sehnt sich danach, dass die Geliebte seine stillen Gedanken versteht. Auch die Ironie des Gedichts manifestiert sich hier: Der Sprecher kritisiert diejenigen, die ihre Gefühle vortäuschen und nicht aus tiefstem Herzen lieben, während er selbst unter der Unfähigkeit leidet, seine Gefühle zu äußern. Die sprachliche Gestaltung, besonders die Verwendung von „vür“ (für) und „sîn“ (sein), verdeutlicht die Kluft zwischen dem Erlebten und dem Ausgedrückten.
In den Strophen IV und V wird das Wesen der Liebe reflektiert. Das lyrische Ich fragt sich, wie die Liebe, die als „herzeliebe“ bezeichnet wird, wirklich zu verstehen ist, da sie sowohl Freude als auch Leid mit sich bringt. Die Sehnsucht nach der Geliebten und die daraus resultierende Traurigkeit stehen im Kontrast zu der Freude, die sie in ihm auslöst. Das Gedicht endet mit der Hoffnung, die Geliebte möge nicht jedem so herzlich wie ihm zulächeln. Trotz aller Schmerzhaftigkeit und der Ungewissheit über die Reaktionen der Geliebten, überwiegt die Freude an ihrer Anwesenheit.
Insgesamt ist das Gedicht ein komplexes Portrait der höfischen Liebe, die von Sehnsucht, Leid und der Sehnsucht nach Nähe geprägt ist. Die klare Sprache, die subtile Verwendung von Bildern und die klaren Reimschemata verdeutlichen die Zerrissenheit des Sprechers. Es ist ein eindrucksvolles Zeugnis der menschlichen Erfahrung von Liebe, die gleichermaßen beglücken und quälen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.