Wo erfrag ich den Freund, wo find ich, was ich verlohren,
Sage es Morgenroth mir, wo mein Geliebter verweilt!
Weihet der Priester den Schleier, der den, dich mir o Lieber vereinigt,
Hält ein fremdes Gesez stets dich entfernet von mir?
Aber der Morgen verstumt, verschlungen vom glühenden Tage;
Abendroth, sage es mir, freundlicher milderer Schein!
Aber es färbt sich die Wange des Abendroths blässer und blässer,
Und es streuet auf mich wehmutsvoll perlenden Thau hin.
Frag ich die Sterne, sie schweigen, verglimmen leise im Osten,
Aber der Morgen kehrt wieder, und wieder erröthet der Abend,
Und der ewige Kreis führet die Sterne zurük.
Kehret der Morgen einst wieder, dann möge der Mittag
Gierig schlingen den Morgen, und über mir grüssen die Sterne
Mich verschlinge die Nacht, bis jenseits des Dunkels
Wieder der Liebe Ton goldner Morgen entsprießt.
Wo erfrag ich den Freund
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
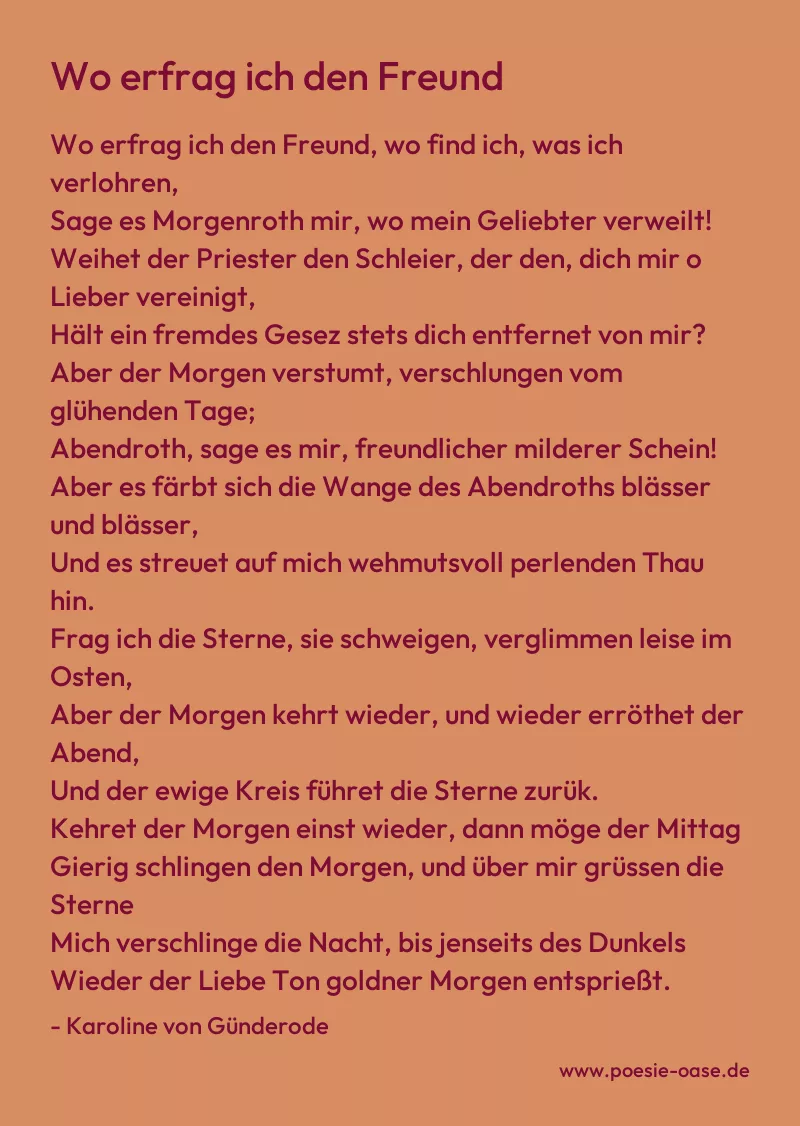
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wo erfrag ich den Freund“ von Karoline von Günderode ist eine ergreifende Suche nach einem verlorenen Geliebten und eine Reflexion über die Natur der Sehnsucht und des unerfüllten Begehrens. Es ist durchzogen von einer tiefen Melancholie und dem Gefühl der Trennung, das sich in der verzweifelten Frage nach dem Verbleib des Geliebten manifestiert. Die Autorin wendet sich an die Natur, an den Morgen, den Abend und die Sterne, um Trost und Antworten zu finden, doch ihre Suche bleibt letztendlich unbeantwortet, was die Intensität ihrer Verzweiflung noch verstärkt.
Die zentralen Elemente des Gedichts sind die Natur, die als Spiegel der Emotionen der Autorin dient, sowie die Zeit, die als ein Kreislauf aus Hoffnung und Enttäuschung erlebt wird. Der Morgen, der Abend und die Sterne symbolisieren verschiedene Phasen und Aspekte der Sehnsucht. Der Morgen wird mit der Hoffnung auf Wiedersehen assoziiert, der Abend mit der Sehnsucht nach Trost und die Sterne mit der Unendlichkeit und Ewigkeit. Die wiederholte Frage nach dem Geliebten und die anschließende Stille der Natur unterstreichen das Gefühl der Isolation und die Unfähigkeit, die verlorene Verbindung wiederherzustellen. Das „fremde Gesez“, das den Geliebten fernhält, deutet auf äußere Hindernisse und Umstände hin, die die Liebenden trennen.
Die Sprache des Gedichts ist geprägt von einer subtilen Eleganz und einer tiefen Emotionalität. Die Verwendung von Fragen, Ausrufen und Bildern der Natur erzeugt eine Atmosphäre der Intimität und des persönlichen Leidens. Die rhetorischen Fragen, die an die Elemente der Natur gerichtet werden, zeugen von der Hilflosigkeit und der Sehnsucht nach einer Antwort. Die Metaphern, wie die „Wange des Abendroths“, die blass wird, und der „perlende Thau“, der als Ausdruck des Kummers dient, verstärken die emotionale Wirkung des Gedichts.
Das Ende des Gedichts, in dem die Autorin den Wunsch nach der Nacht und dem Tod äußert, offenbart einen tiefen Wunsch nach Erlösung und Wiedervereinigung. Die Vorstellung, von der Nacht verschlungen zu werden, bis „jenseits des Dunkels / Wieder der Liebe Ton goldner Morgen entsprießt“, ist ein Ausdruck der Hoffnung auf ein Wiedersehen in einer transzendenten Welt, in der die Trennung aufgehoben ist. Dies deutet auf einen starken Glauben an die Ewigkeit der Liebe und die Überwindung des irdischen Leids hin. Günderodes Gedicht ist somit eine Ode an die Sehnsucht, die Hoffnung und die ewige Suche nach der Liebe.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
