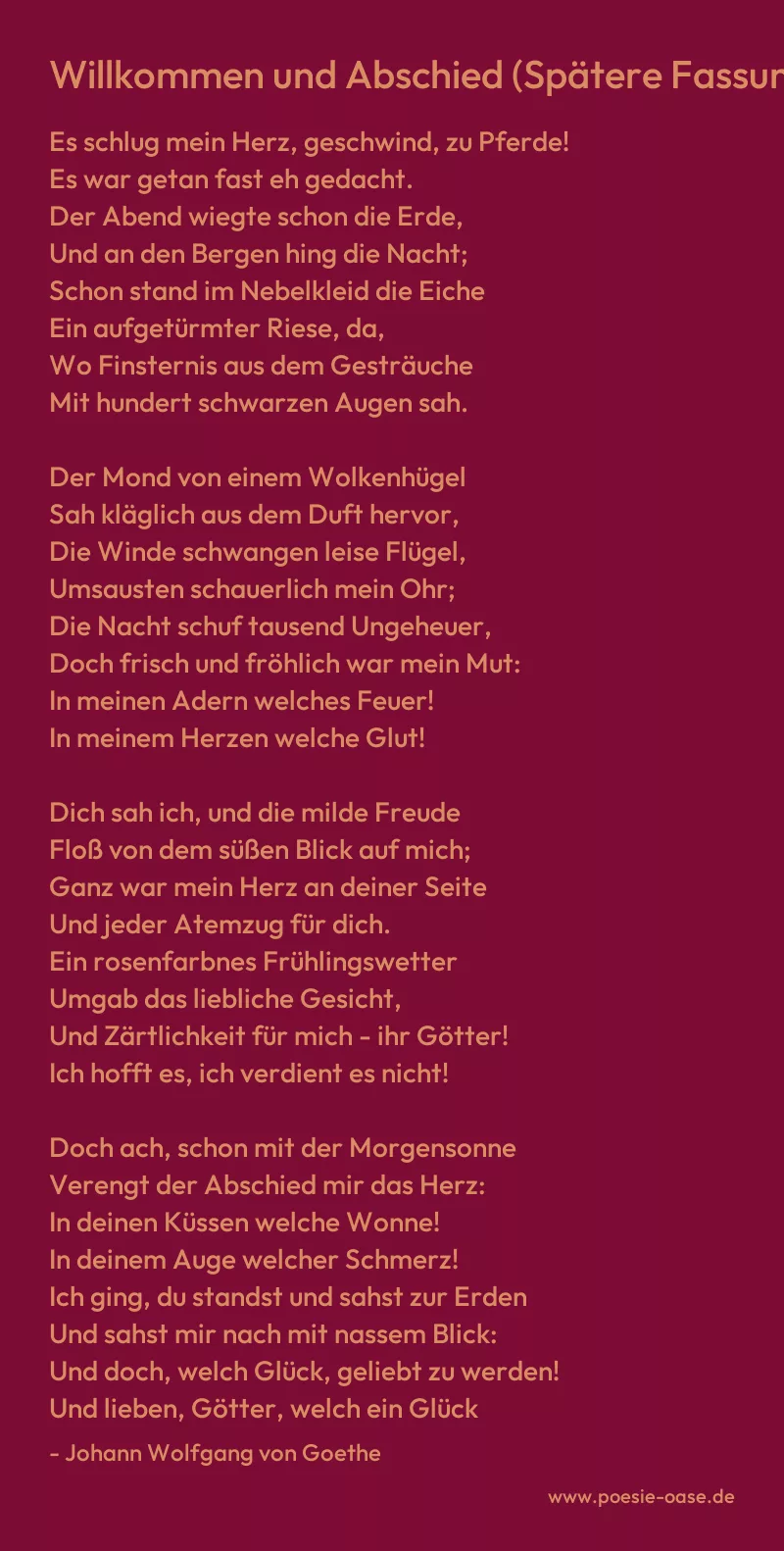Emotionen & Gefühle, Feiertage, Freude, Helden & Prinzessinnen, Heldenmut, Himmel & Wolken, Legenden, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Natur, Tiere, Vergänglichkeit, Wälder & Bäume, Weisheiten, Wut
Willkommen und Abschied (Spätere Fassung, ca.1785)
Es schlug mein Herz, geschwind, zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.
Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!
Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich – ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!
Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
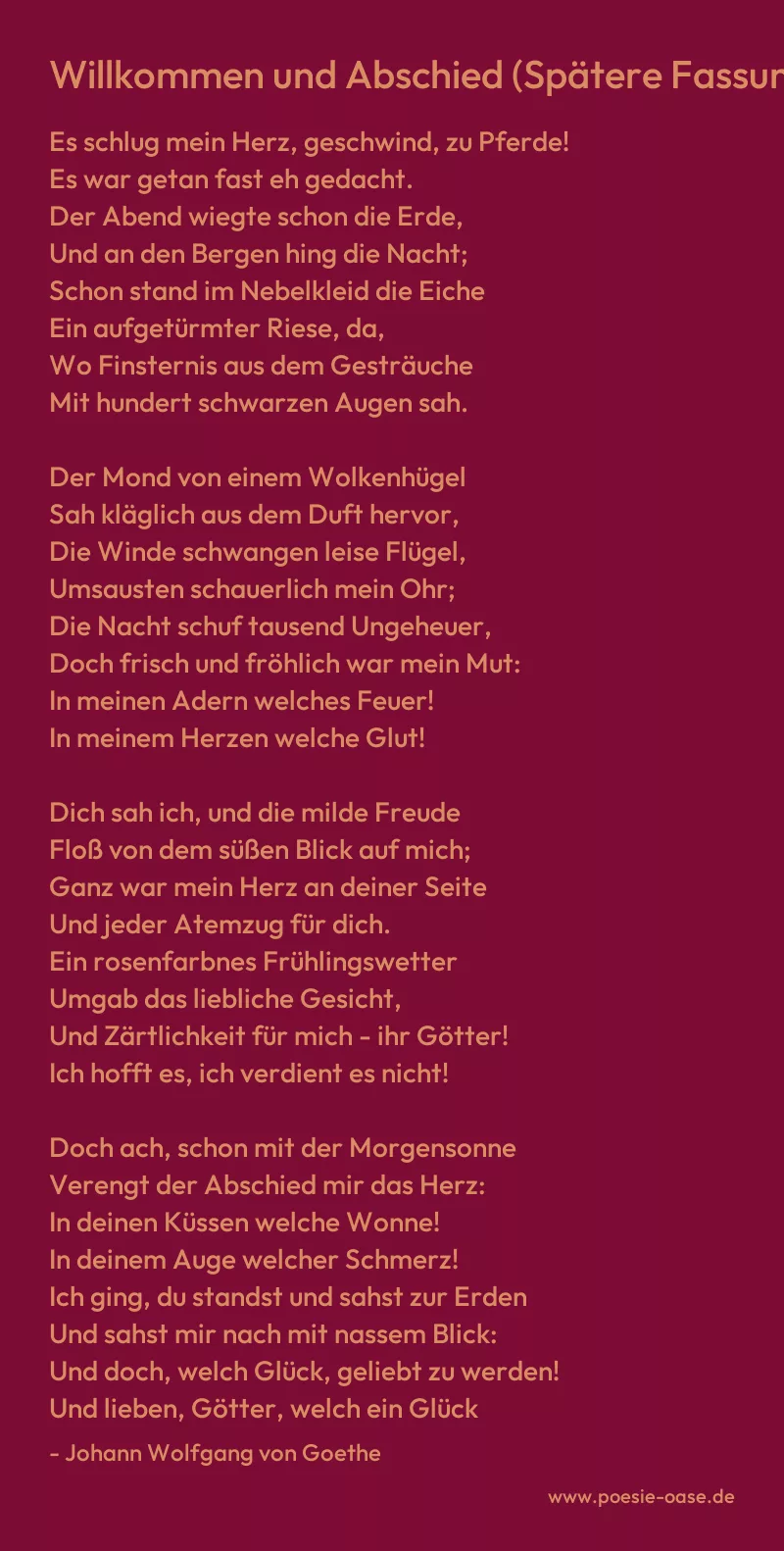
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Willkommen und Abschied“ von Johann Wolfgang von Goethe (spätere Fassung) ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Höhen und Tiefen der jugendlichen Liebe, eingefangen in einer lebendigen Naturkulisse. Es zeichnet den Bogen von der Aufbruchsstimmung des Verliebtseins über die glücklichen Momente des Zusammenseins bis hin zum schmerzlichen Abschied und der Erkenntnis, dass Liebe sowohl Freude als auch Leid mit sich bringt. Die Verwendung von Naturmetaphern, insbesondere die Beschreibung der Abendstimmung und der Nacht, verstärkt die emotionale Intensität des Gedichts und spiegelt die innere Gefühlswelt des lyrischen Ichs wider.
Die erste Strophe beschreibt den stürmischen Aufbruch des lyrischen Ichs, getrieben von einem unbändigen Gefühl der Sehnsucht und Vorfreude. Die Worte „Es schlug mein Herz, geschwind, zu Pferde!“ drücken die Unmittelbarkeit und Unbändigkeit dieser Emotion aus. Die Natur, dargestellt durch die sich verdunkelnde Abendlandschaft und die „aufgetürmte[n] Riese[n]“ der Eichen, wird zum Spiegelbild der aufgewühlten Seele des Sprechers. Die „Finsternis“ und die „schwarzen Augen“ verstärken die geheimnisvolle und zugleich beängstigende Atmosphäre, die das Unbekannte und die Aufregung des bevorstehenden Treffens andeutet.
Die zweite Strophe transportiert die Leser*innen in die Welt der berauschenden Glücksgefühle, die das lyrische Ich während des Zusammentreffens mit der Geliebten erlebt. Die Natur, die zuvor düster und bedrohlich wirkte, wandelt sich in ein sanftes und wohlgesinntes Bild. Der Mond, der „kläglich“ aus dem Nebel hervorleuchtete, die „Winde“, die „schauerlich“ ums Ohr sausten, verlieren ihren Schrecken und verwandeln sich in eine Kulisse der Zärtlichkeit und des Glücks. Die „tausend Ungeheuer“ der Nacht werden von der „frisch und fröhlich[en]“ Seele des Sprechers überwunden, in der „Feuer“ und „Glut“ lodern.
In der dritten und vierten Strophe erreicht die Liebe ihren Höhepunkt und ihren Abschied. Die Begegnung mit der Geliebten wird als ein Moment der absoluten Erfüllung beschrieben, in dem „jeder Atemzug“ dem geliebten Wesen gewidmet ist. Die „Rosenfarbnes Frühlingswetter“ und die „Zärtlichkeit“ vermitteln ein Gefühl der Vollkommenheit. Doch der Abschied, mit dem Erwachen der „Morgensonne“, reißt das lyrische Ich aus diesem Glück. Die Abschiedsschmerz, die „Wonne“ der Küsse und der „Schmerz“ im Blick der Geliebten, werden mit tiefem Gefühl ausgedrückt. Das Gedicht endet mit einer Doppelklarheit: Die Liebe ist trotz aller Schmerzen ein unbeschreibliches Glück, sowohl geliebt zu werden als auch zu lieben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.