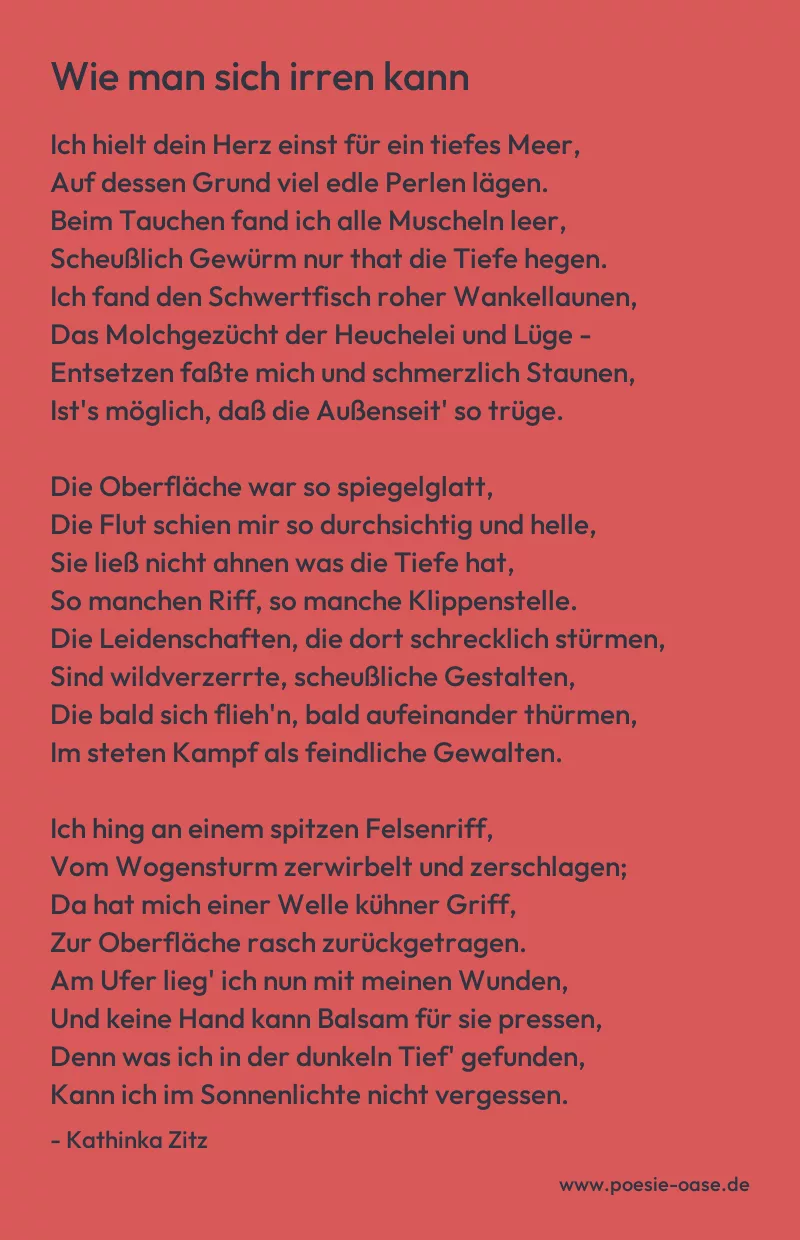Wie man sich irren kann
Ich hielt dein Herz einst für ein tiefes Meer,
Auf dessen Grund viel edle Perlen lägen.
Beim Tauchen fand ich alle Muscheln leer,
Scheußlich Gewürm nur that die Tiefe hegen.
Ich fand den Schwertfisch roher Wankellaunen,
Das Molchgezücht der Heuchelei und Lüge –
Entsetzen faßte mich und schmerzlich Staunen,
Ist’s möglich, daß die Außenseit‘ so trüge.
Die Oberfläche war so spiegelglatt,
Die Flut schien mir so durchsichtig und helle,
Sie ließ nicht ahnen was die Tiefe hat,
So manchen Riff, so manche Klippenstelle.
Die Leidenschaften, die dort schrecklich stürmen,
Sind wildverzerrte, scheußliche Gestalten,
Die bald sich flieh’n, bald aufeinander thürmen,
Im steten Kampf als feindliche Gewalten.
Ich hing an einem spitzen Felsenriff,
Vom Wogensturm zerwirbelt und zerschlagen;
Da hat mich einer Welle kühner Griff,
Zur Oberfläche rasch zurückgetragen.
Am Ufer lieg‘ ich nun mit meinen Wunden,
Und keine Hand kann Balsam für sie pressen,
Denn was ich in der dunkeln Tief‘ gefunden,
Kann ich im Sonnenlichte nicht vergessen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
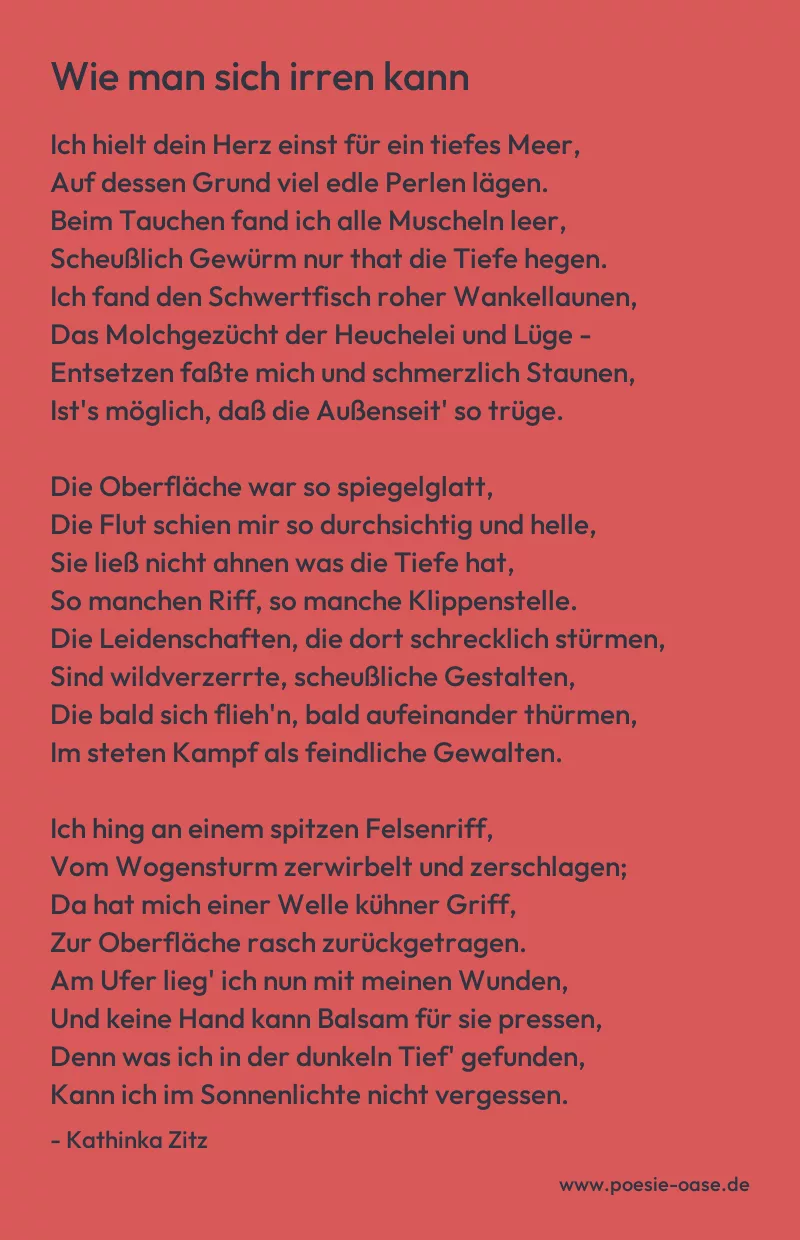
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wie man sich irren kann“ von Kathinka Zitz ist eine eindringliche Metapher für die Enttäuschung und das Erwachen aus einer Illusion über die wahre Natur eines Menschen. Das lyrische Ich beginnt mit einer idealisierten Vorstellung des geliebten Menschen, dessen Herz als tiefes Meer beschrieben wird, in dem edle Perlen zu finden sein sollten. Diese anfängliche Hoffnung und der Glaube an das Gute werden jedoch durch die Erfahrung des „Tauchens“ in dieses Herz abrupt zerstört. Die leeren Muscheln und das „scheußliche Gewürm“ symbolisieren die Enttäuschung und die Erkenntnis, dass sich unter der Oberfläche des geliebten Menschen etwas Hässliches, Verwerfliches verbirgt. Die Metaphern von „Schwertfisch“ und „Molchgezücht“ verstärken das Bild der Verunstaltung und des Verrats, wodurch die anfängliche Idealisierung in ihr Gegenteil verkehrt wird.
Der zweite Teil des Gedichts vertieft die Erkenntnis über die Täuschung. Die „spiegelglatte“ Oberfläche des Meeres und die „durchsichtige und helle“ Flut stehen im Kontrast zu den Gefahren, die in der Tiefe lauern. Die „Leidenschaften“, die als „wildverzerrte, scheußliche Gestalten“ beschrieben werden, veranschaulichen die destruktiven Kräfte, die im Inneren des geliebten Menschen wirken. Diese inneren Konflikte und Stürme werden als „feindliche Gewalten“ dargestellt, die in einem ständigen Kampf miteinander liegen. Die vermeintliche Schönheit und Klarheit der Oberfläche dienen als Täuschung, die das lyrische Ich dazu verleitet, die verborgenen Abgründe nicht zu erkennen.
Die dritte Strophe bringt die emotionale Zerstörung des lyrischen Ichs zum Ausdruck. Durch den metaphorischen „Wogensturm“ wird das Ich an einem „spitzen Felsenriff“ zerschlagen, was die Verletzlichkeit und das Leid verdeutlicht, das durch die Täuschung verursacht wurde. Die „Wunde[n]“ am Ufer symbolisieren die bleibenden Narben, die durch diese Erfahrung entstanden sind. Die Unfähigkeit, die gefundenen „Geheimnisse“ im „Sonnenlichte“ zu vergessen, unterstreicht die Tiefe des Schmerzes und die Unfähigkeit, die erlebte Enttäuschung zu überwinden. Die „Balsam“ für die Wunden kann nicht gefunden werden, was die Hoffnungslosigkeit und die nachhaltige Wirkung des Erlebten hervorhebt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gedicht eine bittere Bilanz über die Täuschung und die Enttäuschung in einer Liebesbeziehung zieht. Zitz verwendet eine kraftvolle Bildsprache, um die Diskrepanz zwischen der anfänglichen Idealisierung und der brutalen Realität der menschlichen Natur darzustellen. Das Gedicht ist nicht nur eine persönliche Klage, sondern auch eine universelle Auseinandersetzung mit dem Schmerz, der entsteht, wenn Ideale und Hoffnungen an den Realitäten der menschlichen Beziehungen zerbrechen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.