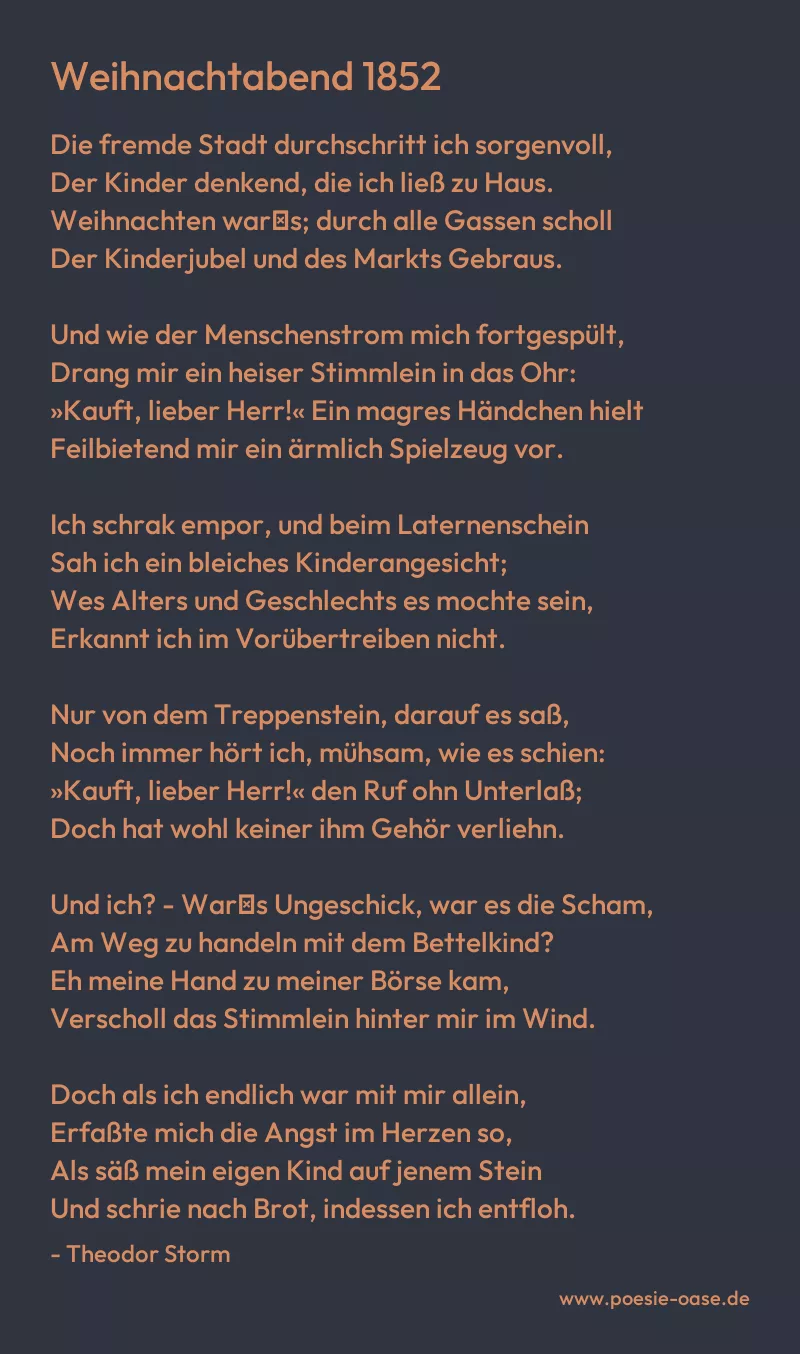Weihnachtabend 1852
Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll,
Der Kinder denkend, die ich ließ zu Haus.
Weihnachten war′s; durch alle Gassen scholl
Der Kinderjubel und des Markts Gebraus.
Und wie der Menschenstrom mich fortgespült,
Drang mir ein heiser Stimmlein in das Ohr:
»Kauft, lieber Herr!« Ein magres Händchen hielt
Feilbietend mir ein ärmlich Spielzeug vor.
Ich schrak empor, und beim Laternenschein
Sah ich ein bleiches Kinderangesicht;
Wes Alters und Geschlechts es mochte sein,
Erkannt ich im Vorübertreiben nicht.
Nur von dem Treppenstein, darauf es saß,
Noch immer hört ich, mühsam, wie es schien:
»Kauft, lieber Herr!« den Ruf ohn Unterlaß;
Doch hat wohl keiner ihm Gehör verliehn.
Und ich? – War′s Ungeschick, war es die Scham,
Am Weg zu handeln mit dem Bettelkind?
Eh meine Hand zu meiner Börse kam,
Verscholl das Stimmlein hinter mir im Wind.
Doch als ich endlich war mit mir allein,
Erfaßte mich die Angst im Herzen so,
Als säß mein eigen Kind auf jenem Stein
Und schrie nach Brot, indessen ich entfloh.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
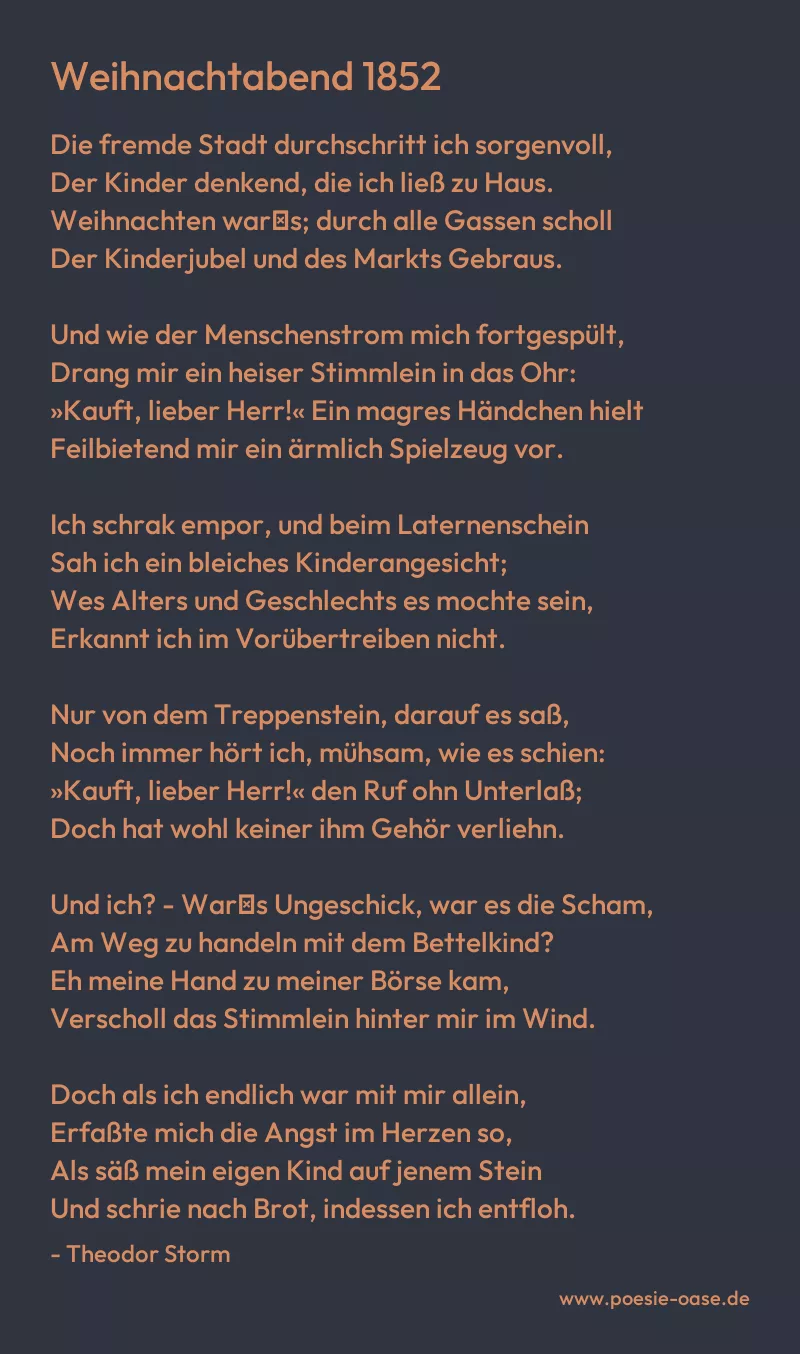
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Weihnachtabend 1852“ von Theodor Storm ist eine bewegende Reflexion über Armut, Schuld und die Unfähigkeit, in einer weihnachtlichen Umgebung zu helfen. Es beginnt mit dem Gefühl der Einsamkeit und Sorge des Erzählers, der durch eine fremde Stadt geht, während er an seine zu Hause wartenden Kinder denkt. Der Kontrast zwischen der festlichen Stimmung, dem „Kinderjubel und des Markts Gebraus“, und der persönlichen Sorge des Erzählers wird sofort deutlich. Der Erzähler ist also in einer gespaltenen Situation, er ist einerseits ein Teil der Gesellschaft, andererseits ist er in seinen Gedanken weit weg von der aktuellen Situation.
Die eigentliche Konfrontation mit der Armut erfolgt in der Begegnung mit dem bettelnden Kind. Das „magre Händchen“ und das „ärmlich Spielzeug“ sind bildhafte Darstellungen der Not, die der Erzähler in der Hektik des Weihnachtsabends übersieht. Der kurze Dialog mit dem Kind, der hauptsächlich aus dem wiederholten Flehen nach dem Kauf des Spielzeugs besteht, verstärkt die tragische Situation. Die Unsicherheit des Erzählers in Bezug auf das Alter und Geschlecht des Kindes unterstreicht die allgemeine Verwirrung und Distanziertheit des Erzählers.
Die eigentliche Tragik liegt in der Untätigkeit des Erzählers. Ob es „Ungeschick“ oder „Scham“ war, das ihn hinderte, dem Kind zu helfen, bleibt offen, aber die Konsequenz ist eindeutig: Er geht weiter, ohne zu handeln. Der Wendepunkt des Gedichts ist der Moment der Erkenntnis, als ihn die Angst erfasst, dass sein eigenes Kind in einer ähnlichen Situation sein könnte. Die Vorstellung, dass sein eigenes Kind „nach Brot schreien“ könnte, während er „entfloh“, erzeugt ein starkes Gefühl von Schuld und Reue.
Das Gedicht nutzt eine einfache, aber wirkungsvolle Sprache und Bilder, um die emotionale Tiefe der Situation zu vermitteln. Die wiederholte Bitte des Kindes, der Kontrast zwischen dem fröhlichen Weihnachtstreiben und der Armut, sowie die innere Zerrissenheit des Erzählers machen das Gedicht zu einer eindringlichen Kritik an der Gleichgültigkeit gegenüber den Schwachen. Storms Gedicht hinterlässt ein Gefühl der Unversöhnlichkeit und des Bedauerns, das über die Weihnachtszeit hinausreicht und die Leser zum Nachdenken über ihre eigene Verantwortung gegenüber anderen anregt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.