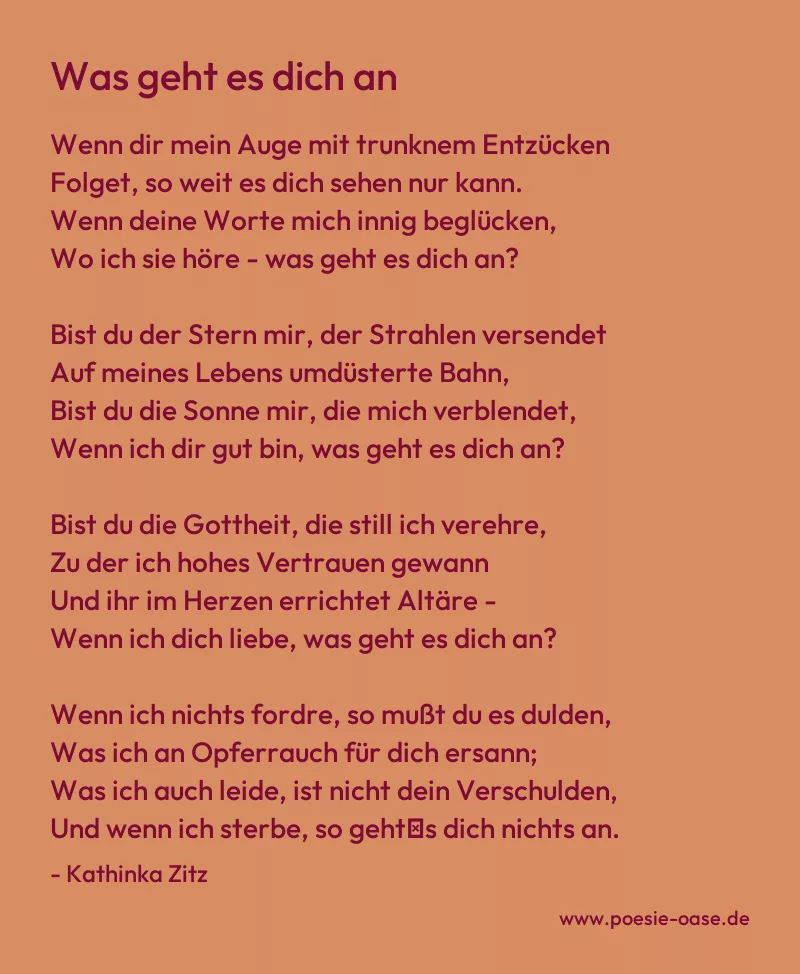Was geht es dich an
Wenn dir mein Auge mit trunknem Entzücken
Folget, so weit es dich sehen nur kann.
Wenn deine Worte mich innig beglücken,
Wo ich sie höre – was geht es dich an?
Bist du der Stern mir, der Strahlen versendet
Auf meines Lebens umdüsterte Bahn,
Bist du die Sonne mir, die mich verblendet,
Wenn ich dir gut bin, was geht es dich an?
Bist du die Gottheit, die still ich verehre,
Zu der ich hohes Vertrauen gewann
Und ihr im Herzen errichtet Altäre –
Wenn ich dich liebe, was geht es dich an?
Wenn ich nichts fordre, so mußt du es dulden,
Was ich an Opferrauch für dich ersann;
Was ich auch leide, ist nicht dein Verschulden,
Und wenn ich sterbe, so geht′s dich nichts an.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
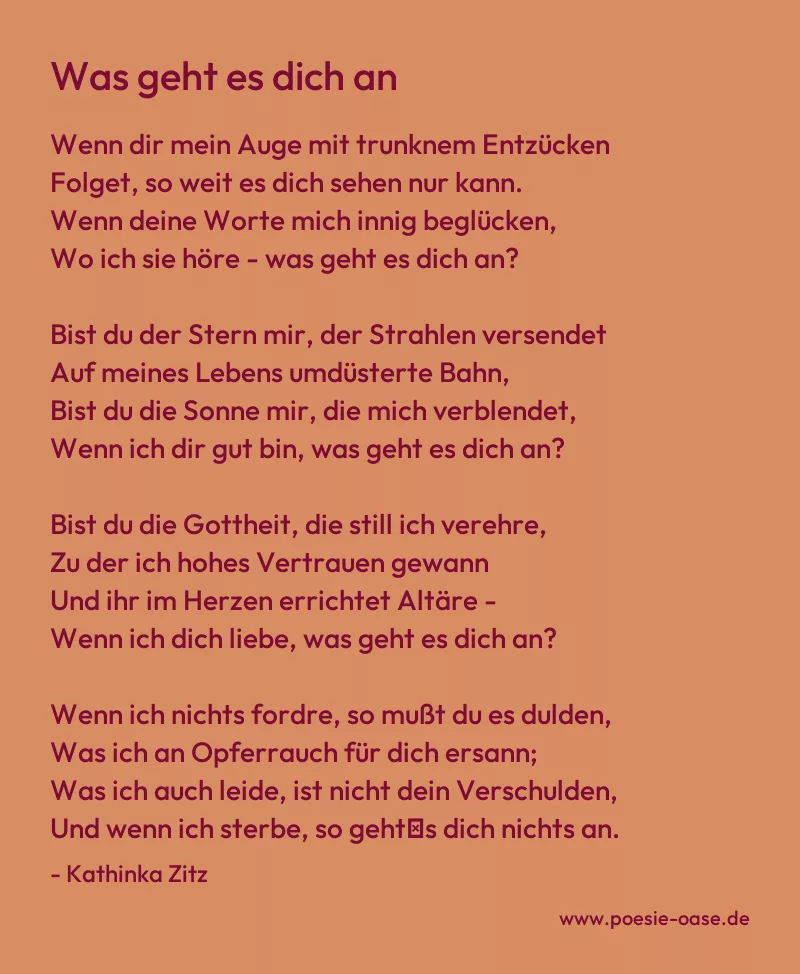
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Was geht es dich an“ von Kathinka Zitz ist eine leidenschaftliche Deklaration der Liebe und der individuellen Gefühlswelt, die sich von den Erwartungen und Urteilen anderer abgrenzt. Die Autorin greift das zentrale Thema der ungestillten, einseitigen Liebe auf und betont die Freiheit der Liebenden, ihre Gefühle zu leben, ohne sich um die Meinungen oder Einmischungen des geliebten Menschen kümmern zu müssen. Die rhetorische Frage „Was geht es dich an?“ zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gedicht und unterstreicht die Unabhängigkeit des Ichs in seinen Gefühlen.
Das Gedicht ist in vier Strophen unterteilt, jede Strophe beginnt mit der Beschreibung einer intensiven Reaktion des lyrischen Ichs auf die Präsenz oder die Worte der geliebten Person. Ob es das sehnsüchtige Verfolgen mit den Augen, die Freude über die Worte des Geliebten oder die tiefe Verehrung ist, die das lyrische Ich empfindet, die Reaktionen sind stets intensiv und unmittelbar. Die Verwendung von Bildern wie dem „Stern“, der „Sonne“ und der „Gottheit“ verstärkt die Größe und Bedeutung, die die geliebte Person im Leben des lyrischen Ichs einnimmt. Diese Bilder deuten auf eine Verehrung hin, die über das bloße Gefühl der Liebe hinausgeht und eine spirituelle Dimension annimmt.
Die rhetorische Frage am Ende jeder Strophe ist der Kern des Gedichts. Sie dient nicht nur als eine sprachliche Wiederholung, sondern auch als eine Abgrenzung. Das lyrische Ich stellt klar, dass die Intensität und der Ausdruck seiner Gefühle Privatsache sind und niemanden etwas angehen. Die letzte Strophe, die von Opfern, Leiden und sogar dem Tod spricht, verdeutlicht die Ernsthaftigkeit und die Tragweite der Gefühle. Selbst wenn das lyrische Ich bereit ist, große Opfer zu bringen oder an seinen Gefühlen zu sterben, geht es den Geliebten nichts an.
Die Form des Gedichts – die klare Struktur der vier Strophen, die regelmäßige Reimschema (ABAB) und die prägnante Sprache – unterstützt die Klarheit und Direktheit der Aussage. Zitz verwendet eine einfache, aber wirkungsvolle Sprache, um ihre Gefühle auszudrücken. Dies unterstreicht die Ehrlichkeit und Unmittelbarkeit des Gefühlslebens, das sich in den Versen spiegelt. Die Wiederholung der rhetorischen Frage verstärkt die Botschaft der Unabhängigkeit und der Selbstbestimmung in der Liebe. Das Gedicht feiert die persönliche Freiheit in der Liebe, die unabhängig von der Reaktion des Geliebten existieren kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.