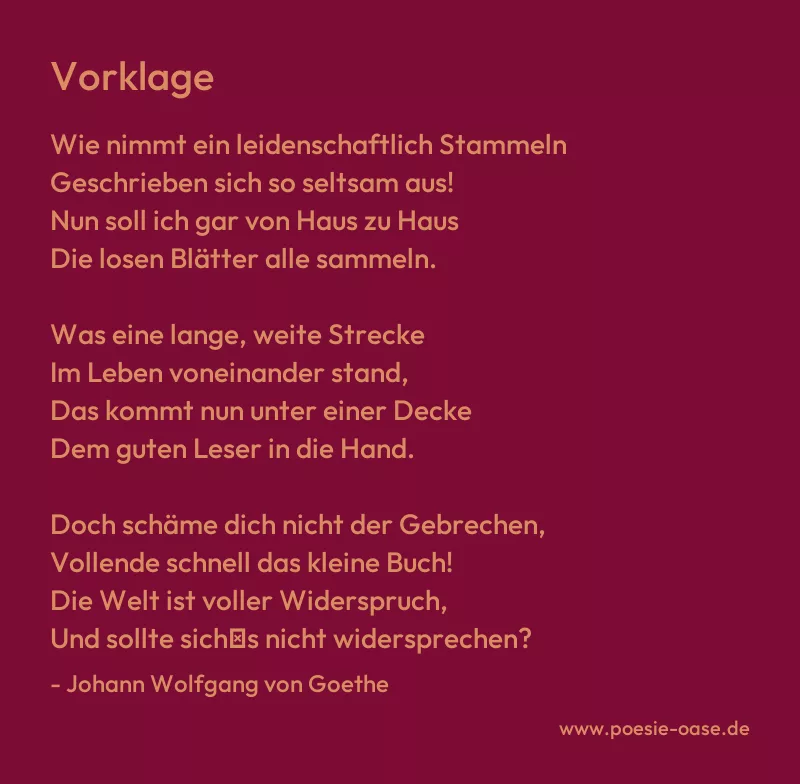Vorklage
Wie nimmt ein leidenschaftlich Stammeln
Geschrieben sich so seltsam aus!
Nun soll ich gar von Haus zu Haus
Die losen Blätter alle sammeln.
Was eine lange, weite Strecke
Im Leben voneinander stand,
Das kommt nun unter einer Decke
Dem guten Leser in die Hand.
Doch schäme dich nicht der Gebrechen,
Vollende schnell das kleine Buch!
Die Welt ist voller Widerspruch,
Und sollte sich′s nicht widersprechen?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
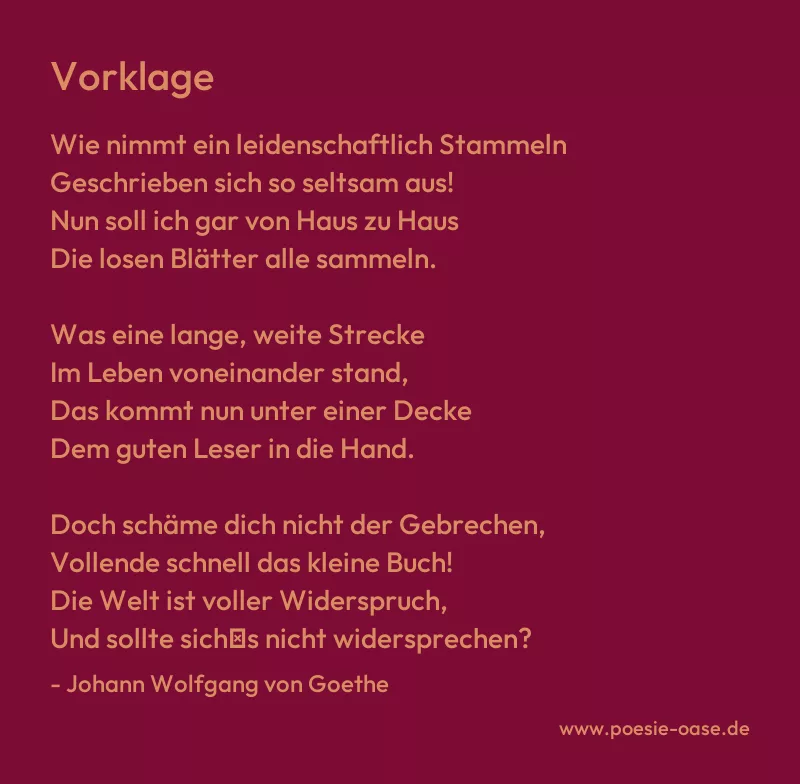
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vorklage“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine Reflexion über den Schreibprozess, die Unvollkommenheit der Kunst und die Beziehung zwischen Autor und Leser. Es beginnt mit der Beobachtung, wie ein leidenschaftlicher Ausdruck – ein „leidenschaftlich Stammeln“ – in geschriebener Form seltsam wirken kann. Dies deutet auf die Schwierigkeit hin, Gefühle und Erfahrungen in Sprache zu fassen, und auf die Distanz, die zwischen dem ursprünglichen Erleben und der schriftlichen Aufzeichnung entsteht. Der erste Vers wirft Fragen nach der Authentizität und den Herausforderungen der künstlerischen Darstellung auf. Die anschließende Aufgabe, „die losen Blätter alle sammeln“, impliziert eine Notwendigkeit zur Ordnung und Vollständigkeit, die im Kontrast zur ursprünglichen Spontaneität steht.
Der zweite Abschnitt des Gedichts verlagert den Fokus auf das fertige Werk und dessen Präsentation. Die Zeilen beschreiben, wie scheinbar getrennte Aspekte des Lebens, die über einen längeren Zeitraum hinweg existierten, nun in einem einzigen Buch zusammengeführt werden. Diese Zusammenfassung und das Aufeinandertreffen von Erfahrungen, die „im Leben voneinander stand“, erzeugt beim Leser eine neue Perspektive. Der Autor scheint die Erwartung zu haben, dass der Leser die Zusammenhänge der Lebenserfahrungen versteht. Die Formulierung „Dem guten Leser in die Hand“ unterstreicht die Bedeutung der Beziehung zwischen dem Autor und seinem Publikum und die Hoffnung auf eine wohlwollende Rezeption.
Im letzten Teil des Gedichts wird die Akzeptanz der Unvollkommenheit thematisiert. Der Autor ermutigt sich selbst, sich nicht für die „Gebrechen“ – also die Unvollkommenheiten des Werkes – zu schämen, sondern das „kleine Buch“ schnell zu vollenden. Dies ist eine Anerkennung, dass jedes Kunstwerk Mängel aufweist, und eine Aufforderung, diese Mängel im Namen der Fertigstellung und des Gesamtziels, nämlich der Veröffentlichung, zu akzeptieren. Die abschließende Feststellung, „Die Welt ist voller Widerspruch, / Und sollte sich′s nicht widersprechen?“, bekräftigt die Idee, dass Widersprüche und Unvollkommenheiten nicht nur unvermeidlich, sondern vielleicht sogar ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens und der Kunst sind.
Insgesamt ist „Vorklage“ ein meta-poetisches Gedicht, das die Herausforderungen und die Ambivalenz des Schreibens thematisiert. Es behandelt Themen wie die Schwierigkeit, Emotionen in Sprache zu fassen, die Notwendigkeit der Selbstreflexion und die Akzeptanz der Unvollkommenheit im kreativen Prozess. Goethe reflektiert über die Beziehung zwischen Autor, Werk und Leser, und unterstreicht letztendlich die Bedeutung von Authentizität und der Bereitschaft, das eigene Werk zu vollenden, trotz seiner unvermeidlichen Mängel.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.