Scheltet, ich bitte, mich nicht! Ich machte, beim delphischen Gotte,
Nur die Verse; die Welt, nahm ich, ihr wißts, wie sie steht.
Verwahrung
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
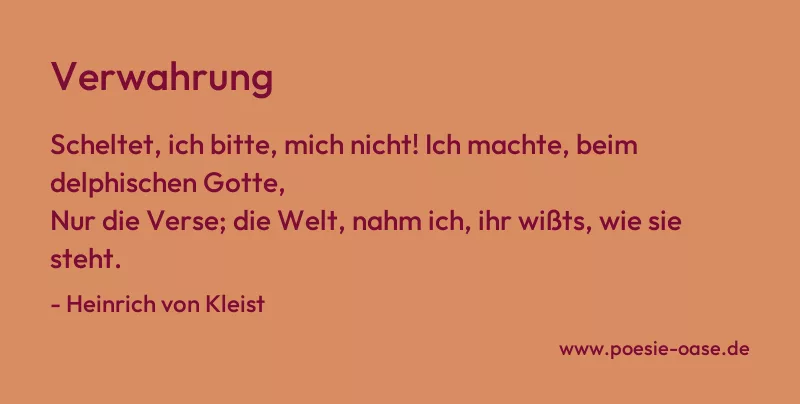
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Verwahrung“ von Heinrich von Kleist ist eine knappe, aber bemerkenswerte Selbstverteidigung des Dichters. Es ist ein Bekenntnis zur künstlerischen Verantwortlichkeit und eine Rechtfertigung für die Schaffung der Verse, die, so Kleist impliziert, nicht seine persönliche Sichtweise widerspiegeln, sondern die Realität, wie sie ist. Die wenigen Worte sind durchzogen von einer gewissen Distanz, einem Gefühl, dass der Dichter nicht für die Welt verantwortlich gemacht werden möchte, die er in seinen Werken abbildet.
Die zentrale Botschaft des Gedichts ist die Trennung von Künstler und Kunstwerk. Kleist bittet darum, nicht für die Inhalte seiner Werke verantwortlich gemacht zu werden. Er betont, dass er lediglich die Verse gemacht hat, also das Werk geschaffen hat. Der Inhalt, die Welt, die er in seinen Versen darstellt, existiert unabhängig von ihm, und er hat sie lediglich aufgegriffen und künstlerisch verarbeitet. Der Zusatz „ihr wißt, wie sie steht“ verstärkt diesen Eindruck, da er sich an ein Publikum richtet, das die Welt kennt und versteht.
Bemerkenswert ist die Verwendung des „delphischen Gottes“ – also Apoll – als Gewährsmann. Kleist beruft sich damit auf eine höhere Instanz, auf die Inspiration und die göttliche Ordnung, die er durch seine künstlerische Arbeit offenbar zu erkennen und widerzuspiegeln versucht. Dies hebt das Gedicht von einer bloßen Entschuldigung ab und verleiht ihm eine gewisse philosophische Tiefe. Es deutet an, dass der Dichter nicht nur die Welt abbildet, sondern dies auch unter dem Einfluss höherer Mächte tut.
Die Kürze des Gedichts ist bezeichnend. In nur zwei Zeilen fasst Kleist sein künstlerisches Selbstverständnis zusammen. Die prägnante Formulierung und die klare Trennung von Werk und Welt spiegeln seine reflektierte Natur und seine Selbstwahrnehmung als Künstler wider. Es ist eine Verteidigung, die gleichzeitig eine Mahnung an das Publikum ist, zwischen dem Künstler und der dargestellten Welt zu unterscheiden, und die Komplexität der Kunst anzuerkennen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
