Deutsche zogen nach Rom, warum nicht Russen nach Deutschland?
Jene waren ein Volk, tapfer und markig und frisch,
Und als solches vom Himmel zum Erben der Römer berufen,
Ja, sie blieben′s bis heut, diese sind nur noch Geschmeiß,
Und das schlechtere Volk ward nie noch der Henker des edlern,
Während der lauterste Mensch oft durch den niedrigsten fällt.
Wenn der Russe den Tasso verbessert, der Deutsche die Knute,
Will ich zittern für uns, aber ich warte es ab!
Verschiedener Kasus
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
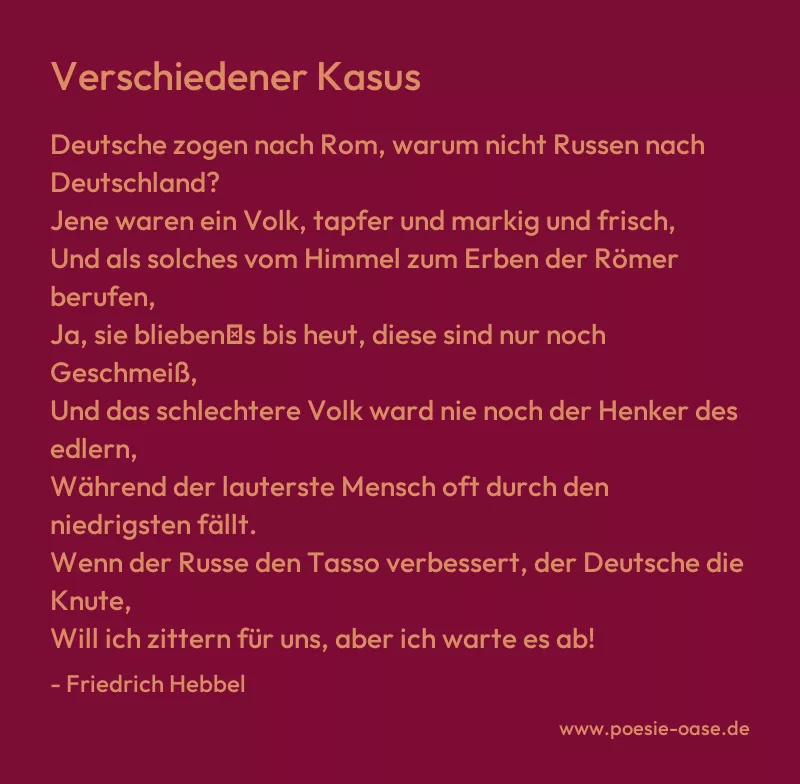
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Verschiedener Kasus“ von Friedrich Hebbel ist eine kritische Reflexion über Geschichte, Identität und die scheinbar unaufhaltsame Veränderung von Völkern und Kulturen. Es beginnt mit einer rhetorischen Frage, die einen Vergleich zwischen dem römischen Reich, erobert durch deutsche Stämme, und der potenziellen Einflussnahme Russlands auf Deutschland herstellt. Dieser Einstieg deutet auf die Sorge des Dichters über die Entwicklung der deutschen Nation und deren Zukunft hin.
Der zweite Teil des Gedichts kontrastiert die Vergangenheit und Gegenwart der Deutschen. Hebbel idealisiert die Germanen als „tapfer und markig und frisch“ und als würdige Erben des römischen Imperiums. Gleichzeitig deutet er an, dass die heutigen Deutschen (im Gegensatz zu ihren Vorfahren) nur noch „Geschmeiß“ sind, eine abwertende Bezeichnung, die auf Verfall und Niedergang hindeutet. Die klare Aussage, „das schlechtere Volk ward nie noch der Henker des edlern“ bekräftigt diese Haltung. Die Implikation ist, dass die Deutschen, einst stark, nun anfällig für eine Unterwerfung durch ein „schwächeres“ Volk wie die Russen sind.
Der Kern des Gedichts liegt in den letzten beiden Versen. Hebbel spekuliert über die kulturellen Auswirkungen eines möglichen russischen Einflusses auf Deutschland. Er malt die beunruhigende Vision, dass die Russen die deutsche Kultur verändern könnten, indem sie einen „Tasso verbessern“ (also die deutsche Literatur beeinflussen) und die Deutschen die „Knute“ (die russische Herrschaftsmethode) übernehmen könnten. Die abschließende Zeile, „Will ich zittern für uns, aber ich warte es ab!“, drückt sowohl Angst als auch abwartende Beobachtung aus. Sie zeigt die Zerrissenheit des Dichters zwischen der Sorge um die Zukunft und dem Wunsch, die Entwicklungen unvoreingenommen zu betrachten.
Hebbel verwendet in diesem Gedicht eine Kombination aus Vergangenheit und Gegenwart, um die aktuelle Situation Deutschlands kritisch zu beleuchten. Die rhetorischen Fragen, der direkte Vergleich, die Verwendung von starken Adjektiven und die abschließende Ungewissheit erzeugen eine beunruhigende Atmosphäre. Das Gedicht ist ein Ausdruck der Besorgnis über den Verlust nationaler Identität und die mögliche Unterwerfung unter ausländische Einflüsse, ein Thema, das in Zeiten politischer und kultureller Umbrüche besonders relevant ist. Es ist ein Appell an die Deutschen, über ihre eigene Geschichte nachzudenken und sich ihrer Werte bewusst zu werden, um ihre Zukunft zu sichern.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
