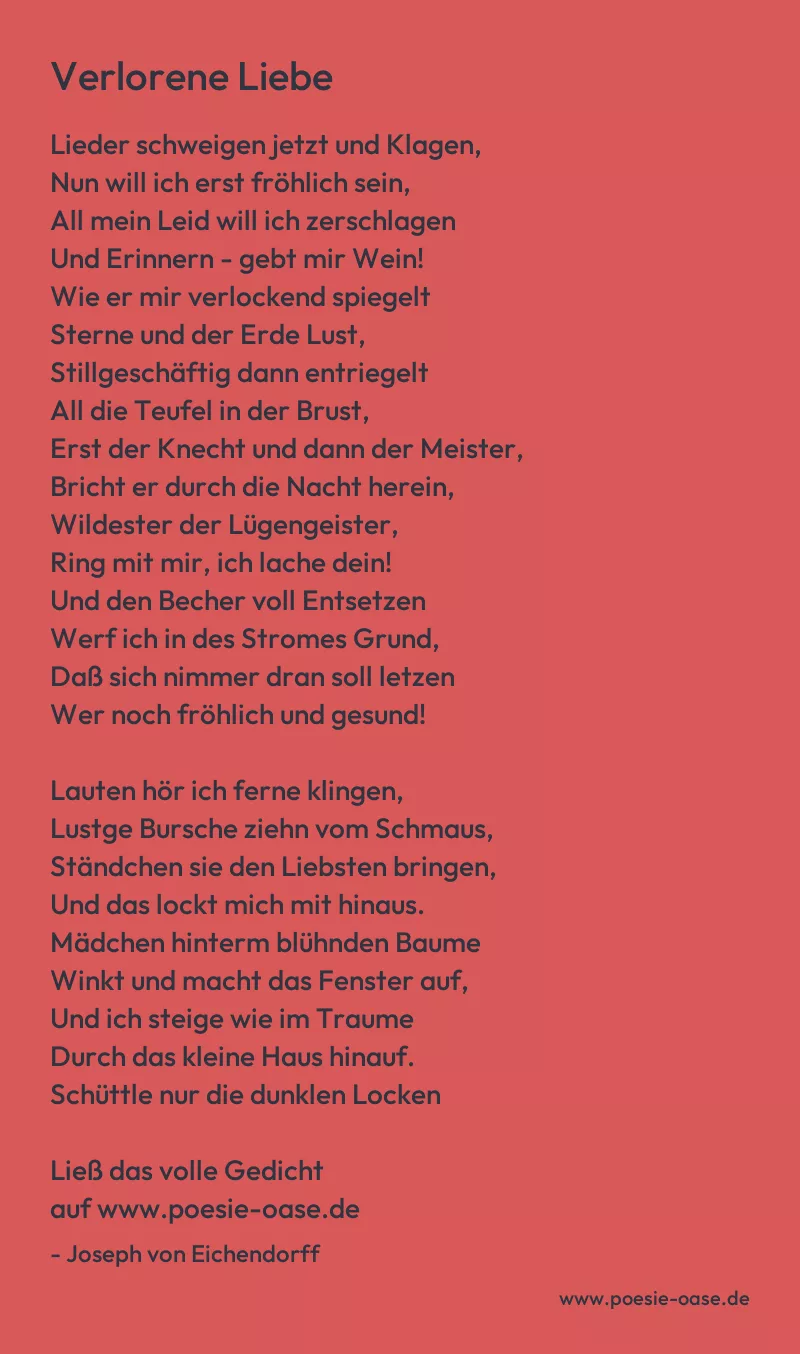Abenteuer & Reisen, Freiheit & Sehnsucht, Frieden, Gegenwart, Götter, Heimat & Identität, Helden & Prinzessinnen, Herzschmerz, Himmel & Wolken, Leidenschaft, Natur, Religion, Universum, Unschuld, Verlust, Wälder & Bäume
Verlorene Liebe
Lieder schweigen jetzt und Klagen,
Nun will ich erst fröhlich sein,
All mein Leid will ich zerschlagen
Und Erinnern – gebt mir Wein!
Wie er mir verlockend spiegelt
Sterne und der Erde Lust,
Stillgeschäftig dann entriegelt
All die Teufel in der Brust,
Erst der Knecht und dann der Meister,
Bricht er durch die Nacht herein,
Wildester der Lügengeister,
Ring mit mir, ich lache dein!
Und den Becher voll Entsetzen
Werf ich in des Stromes Grund,
Daß sich nimmer dran soll letzen
Wer noch fröhlich und gesund!
Lauten hör ich ferne klingen,
Lustge Bursche ziehn vom Schmaus,
Ständchen sie den Liebsten bringen,
Und das lockt mich mit hinaus.
Mädchen hinterm blühnden Baume
Winkt und macht das Fenster auf,
Und ich steige wie im Traume
Durch das kleine Haus hinauf.
Schüttle nur die dunklen Locken
Aus dem schönen Angesicht!
Sieh, ich stehe ganz erschrocken:
Das sind ihre Augen licht,
Locken hatte sie wie deine,
Bleiche Wangen, Lippen rot –
Ach, du bist ja doch nicht meine,
Und mein Lieb ist lange tot!
Hättest du nur nicht gesprochen
Und so frech geblickt nach mir,
Das hat ganz den Traum zerbrochen
Und nun grauet mir vor dir.
Da nimm Geld, kauf Putz und Flimmern,
Fort und lache nicht so wild!
O ich möchte dich zertrümmern,
Schönes, lügenhaftes Bild!
Spät von dem verlornen Kinde
Kam ich durch die Nacht daher,
Fahnen drehten sich im Winde,
Alle Gassen waren leer.
Oben lag noch meine Laute
Und mein Fenster stand noch auf,
Aus dem stillen Grunde graute
Wunderbar die Stadt herauf.
Draußen aber blitzts vom weiten,
Alter Zeiten ich gedacht′,
Schaudernd reiß ich in den Saiten
Und ich sing die halbe Nacht.
Die verschlafnen Nachbarn sprechen,
Daß ich nächtlich trunken sei –
O du mein Gott! und mir brechen
Herz und Saitenspiel entzwei!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
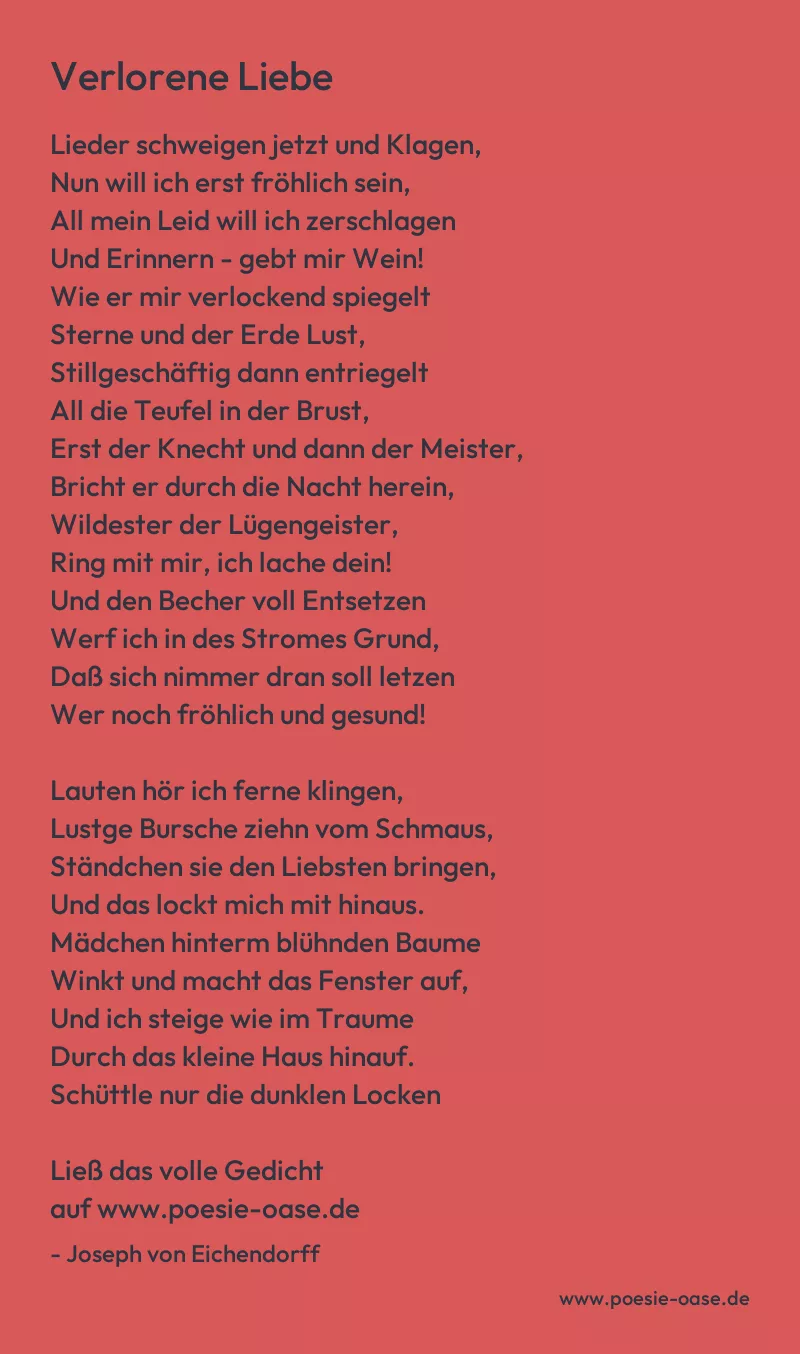
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Verlorene Liebe“ von Joseph von Eichendorff ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Schmerz des Liebesverlustes, der Nostalgie und der daraus resultierenden Zerrissenheit des lyrischen Ichs. Es beginnt mit dem Versuch, den Schmerz durch Wein zu betäuben, und wandelt sich dann in eine Konfrontation mit der Erinnerung an die verlorene Liebe und einer neuen, unerwünschten Begegnung.
Der erste Teil des Gedichts beschreibt den vergeblichen Versuch, die Trauer zu verdrängen. Das lyrische Ich versucht, durch Alkohol (Wein) dem Schmerz zu entfliehen und seine Gefühle zu „zerschlagen“. Der Wein wird als Spiegelbild der Welt gesehen, der sowohl „Sterne und der Erde Lust“ widerspiegelt, als auch die „Teufel in der Brust“ entfesselt. Dies deutet auf einen inneren Konflikt hin, bei dem die Sehnsucht nach Freude und Vergessen von düsteren Erinnerungen und der damit verbundenen Verzweiflung überschattet wird. Der zweite Teil des Gedichts ist durch eine unerwartete Wendung geprägt, in dem das lyrische Ich, angezogen von einer neuen, potentiellen Liebhaberin, in das Haus steigt und plötzlich mit der Realität konfrontiert wird.
Die Begegnung mit der jungen Frau, die die Züge der verlorenen Liebe trägt, wird zur traumatischen Erfahrung. Die Ähnlichkeiten der Frau mit der verlorenen Liebe erwecken falsche Hoffnungen und führen zu einer schmerzlichen Erkenntnis: „Ach, du bist ja doch nicht meine, / Und mein Lieb ist lange tot!“. Die anfängliche Verlockung wandelt sich in Ablehnung und Hass. Der lyrische Sprecher wirft der Frau vor, den Traum zerstört zu haben und fordert sie auf, zu verschwinden. In diesem Moment offenbart sich die tiefe Verletzlichkeit des lyrischen Ichs, das sich von der Wiederbegegnung mit dem Bild der verlorenen Liebe zutiefst verstört fühlt.
Im dritten Teil kehrt das lyrische Ich desillusioniert und einsam in seine eigene Welt zurück. Die nächtliche Szene und die „Fahnen im Wind“ evozieren eine Atmosphäre der Verlorenheit. Die „Laute“ und das „Fenster“ symbolisieren die Verbindung zur vergangenen Liebe und zur Erinnerung. Das lyrische Ich singt und blickt auf die Stadt, die aus dem „stillen Grunde“ heraufdämmert. Die Musik und das Singen werden zu einem Ventil für den Schmerz. Am Ende bricht die Seele des lyrischen Ichs unter der Last der verlorenen Liebe und der erlittenen Enttäuschung.
Die Verwendung von Bildern wie Wein, Sterne, Lügengeister, Traum, Locken und Laute trägt zur emotionalen Tiefe des Gedichts bei. Die Verbindung von Rausch, Visionen und Realität, von Liebe, Verlust und Verzweiflung, macht dieses Gedicht zu einem ausdrucksstarken Zeugnis menschlichen Leids und der Sehnsucht nach Trost und Erlösung. Die Reaktion der Nachbarn („daß ich nächtlich trunken sei“) zeigt zudem die Isolation des lyrischen Ichs, das von seinem Umfeld nicht verstanden wird, was seine Verzweiflung noch verstärkt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.