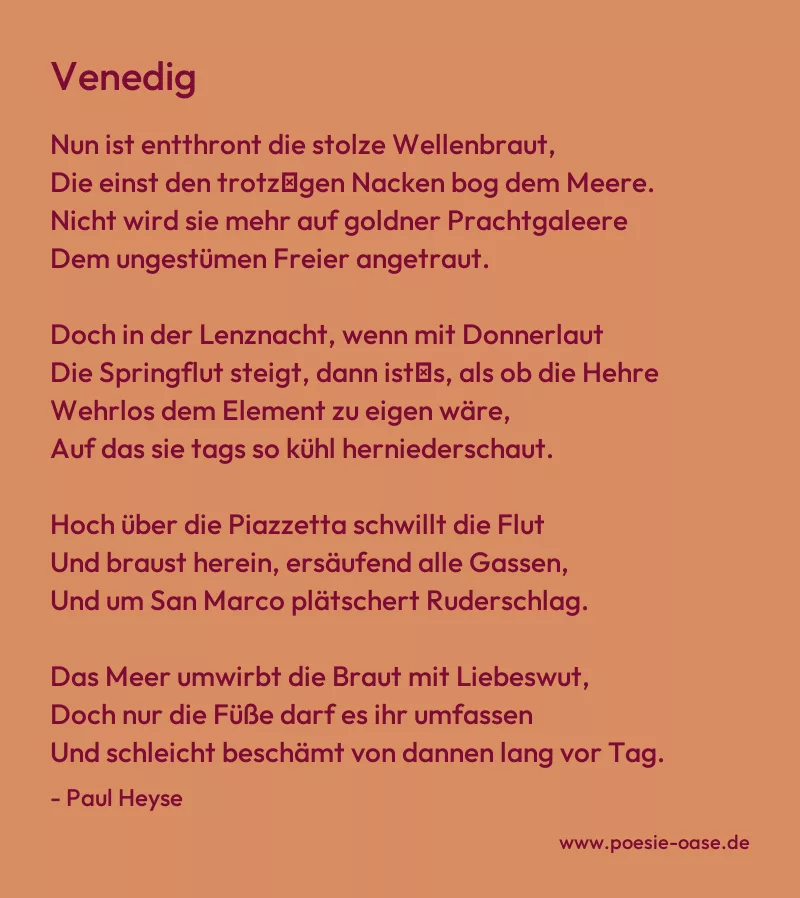Venedig
Nun ist entthront die stolze Wellenbraut,
Die einst den trotz′gen Nacken bog dem Meere.
Nicht wird sie mehr auf goldner Prachtgaleere
Dem ungestümen Freier angetraut.
Doch in der Lenznacht, wenn mit Donnerlaut
Die Springflut steigt, dann ist′s, als ob die Hehre
Wehrlos dem Element zu eigen wäre,
Auf das sie tags so kühl herniederschaut.
Hoch über die Piazzetta schwillt die Flut
Und braust herein, ersäufend alle Gassen,
Und um San Marco plätschert Ruderschlag.
Das Meer umwirbt die Braut mit Liebeswut,
Doch nur die Füße darf es ihr umfassen
Und schleicht beschämt von dannen lang vor Tag.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
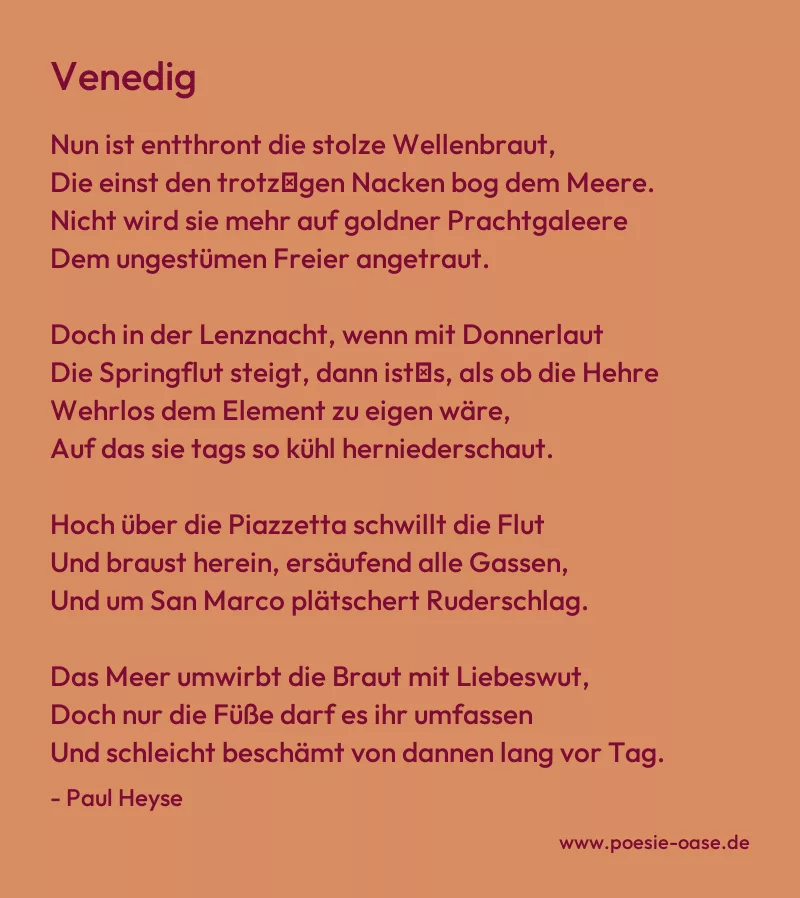
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Venedig“ von Paul Heyse zeichnet ein komplexes Bild der Lagunenstadt, das von Vergänglichkeit, Sehnsucht und der Beziehung zwischen Mensch und Natur geprägt ist. Es beginnt mit einem Eindruck des Verfalls: Die einst stolze „Wellenbraut“ Venedig, die sich dem Meer widersetzte, ist nun entthront. Dieser eröffnende Vers setzt den Ton für eine Betrachtung der Vergangenheit und des Wandels, der sowohl eine physische als auch eine metaphorische Ebene umfasst.
Der zweite Teil des Gedichts, beginnend mit der Lenznacht, bringt eine überraschende Wendung. Hier offenbart sich eine andere Seite Venedigs, in der die Stadt in der Nacht der Frühlingsflut, dem Element des Meeres scheinbar ausgeliefert ist. Dieses Bild kontrastiert stark mit der stolzen, unnahbaren Braut aus den Anfangsversen. Der Wechsel von „goldner Prachtgaleere“ zu „wehrlos“ deutet auf eine gewisse Demütigung, eine Verletzlichkeit, die in der Wiederkehr der Flut zum Ausdruck kommt. Das Meer, der Freier, umgarnt die Stadt, erobert ihre Gassen, doch sein Liebeswerben bleibt letztlich erfolglos.
Die letzten Strophen intensivieren diese Dualität. Die Flut erreicht ihren Höhepunkt, „ersäufend alle Gassen“ und umspülend San Marco. Die Beschreibung der überfluteten Piazzetta und der Ruderschläge unterstreicht die Dynamik und die Macht des Meeres. Doch trotz der Intensität dieser Annäherung bleibt das Meer nur in der Lage, die Füße der Stadt zu umfassen. Die Metapher der Braut, die ihre Würde behält, suggeriert die Unbezwingbarkeit Venedigs, seine ewige Schönheit und seine Fähigkeit, sich dem Wandel und der Zerstörung zu widersetzen.
Letztendlich ist „Venedig“ ein Gedicht über die Dialektik von Macht und Ohnmacht, Schönheit und Vergänglichkeit. Es fängt die Atmosphäre einer Stadt ein, die sowohl majestätisch als auch anfällig ist, und zeigt die beständige Beziehung zwischen Mensch und Natur. Heyse beschreibt Venedig nicht nur als geografischen Ort, sondern als lebendiges Wesen mit einer Geschichte, einer Seele und einer Beziehung zum Element, das sie umgibt. Die Sehnsucht des Meeres nach der Stadt spiegelt vielleicht die Sehnsucht des Menschen nach einer vergangenen, idealisierten Zeit wider, die jedoch durch die Realität der Vergänglichkeit begrenzt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.