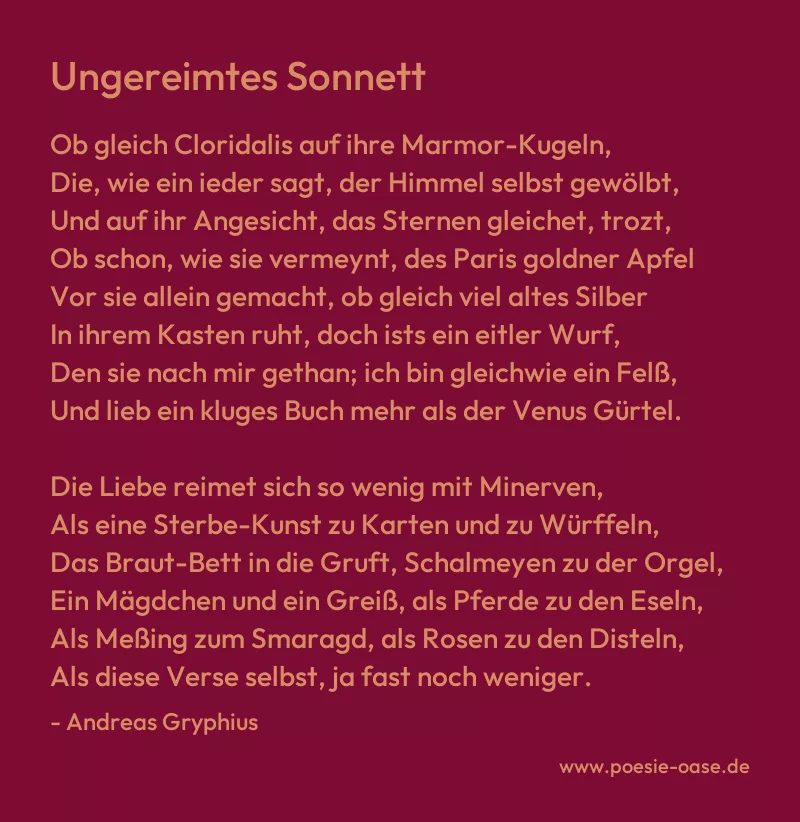Ungereimtes Sonnett
Ob gleich Cloridalis auf ihre Marmor-Kugeln,
Die, wie ein ieder sagt, der Himmel selbst gewölbt,
Und auf ihr Angesicht, das Sternen gleichet, trozt,
Ob schon, wie sie vermeynt, des Paris goldner Apfel
Vor sie allein gemacht, ob gleich viel altes Silber
In ihrem Kasten ruht, doch ists ein eitler Wurf,
Den sie nach mir gethan; ich bin gleichwie ein Felß,
Und lieb ein kluges Buch mehr als der Venus Gürtel.
Die Liebe reimet sich so wenig mit Minerven,
Als eine Sterbe-Kunst zu Karten und zu Würffeln,
Das Braut-Bett in die Gruft, Schalmeyen zu der Orgel,
Ein Mägdchen und ein Greiß, als Pferde zu den Eseln,
Als Meßing zum Smaragd, als Rosen zu den Disteln,
Als diese Verse selbst, ja fast noch weniger.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
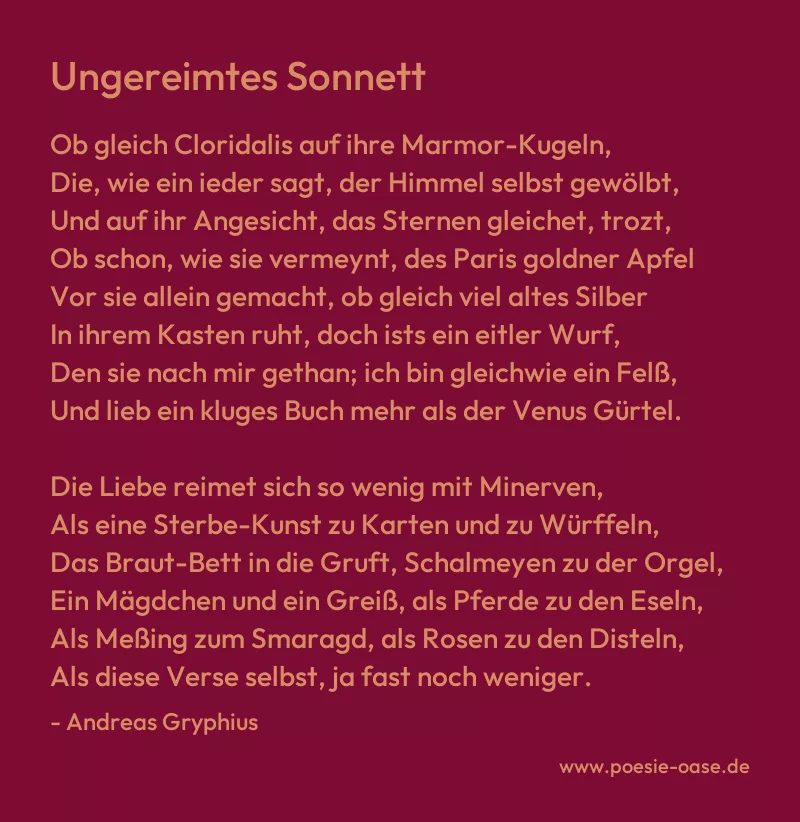
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ungereimtes Sonnett“ von Andreas Gryphius ist eine humorvolle und ironische Absage an die klassische Liebesdichtung und die Verehrung einer geliebten Frau. Das Sonett, das selbst eine strenge Form von Liebeslyrik darstellt, verkehrt hier die traditionellen Konventionen, indem es die scheinbare Schönheit und Anziehungskraft der verehrten „Cloridalis“ in Frage stellt.
Gryphius beginnt mit der Aufzählung von Eigenschaften, die normalerweise in der Liebeslyrik gepriesen werden: „Marmor-Kugeln“ (als Metapher für Brüste), ein strahlendes Antlitz und eine vermeintliche Schönheit, die sogar den mythischen Apfel des Paris wert war. Trotz all dieser äußerlichen Reize, so die Aussage, ist die Wirkung auf den Dichter gering. Er vergleicht sich selbst mit einem Felsen, unbeeindruckt und standhaft, und zieht das „kluge Buch“ der erotischen Anziehung vor. Diese Haltung unterstreicht eine Abkehr vom bloßen Sinnlichen und die Hinwendung zu intellektuellen Werten.
Der zweite Teil des Sonetts entwickelt diese Abkehr weiter, indem er eine Reihe von unvereinbaren Paaren aufzählt, die die Unvereinbarkeit von Liebe und Vernunft, von Schönheit und Klugheit, von Vergnügen und Pflicht verdeutlichen. Die Aufzählung „Die Liebe reimet sich so wenig mit Minerven“ betont diese Gegensätze. Die Wahl des Namens „Minerven“ (der römischen Göttin der Weisheit) steht für das Streben nach Wissen und Vernunft, im Gegensatz zur Liebe, die als spielerisch und unberechenbar wahrgenommen wird. Die weiteren Vergleiche, wie „Braut-Bett in die Gruft“ oder „Rosen zu den Disteln“, verstärken diese Zerrissenheit zwischen Schönheit und Vergänglichkeit, zwischen Freude und Schmerz.
Die Pointe des Sonetts, die mit dem letzten Vers „Als diese Verse selbst, ja fast noch weniger“ erreicht wird, zeigt die Selbstironie des Dichters. Er stellt seine eigenen Verse, die selbst eine Form der Liebesdichtung darstellen, in Frage. Die Ungereimtheit, die er in der Liebe sieht, spiegelt sich in der Form des Sonetts wider, das durch seinen Aufbau eine formale Gereimtheit vorspielt. Die Ironie liegt darin, dass das Sonett selbst ein Ausdruck seiner Abneigung gegen die bloße Oberflächlichkeit der Liebe ist. Es ist eine intellektuelle Auseinandersetzung mit den Konventionen der Liebe und der Liebeslyrik, die die Vorliebe des Dichters für Vernunft, Wissen und Tiefe zum Ausdruck bringt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.