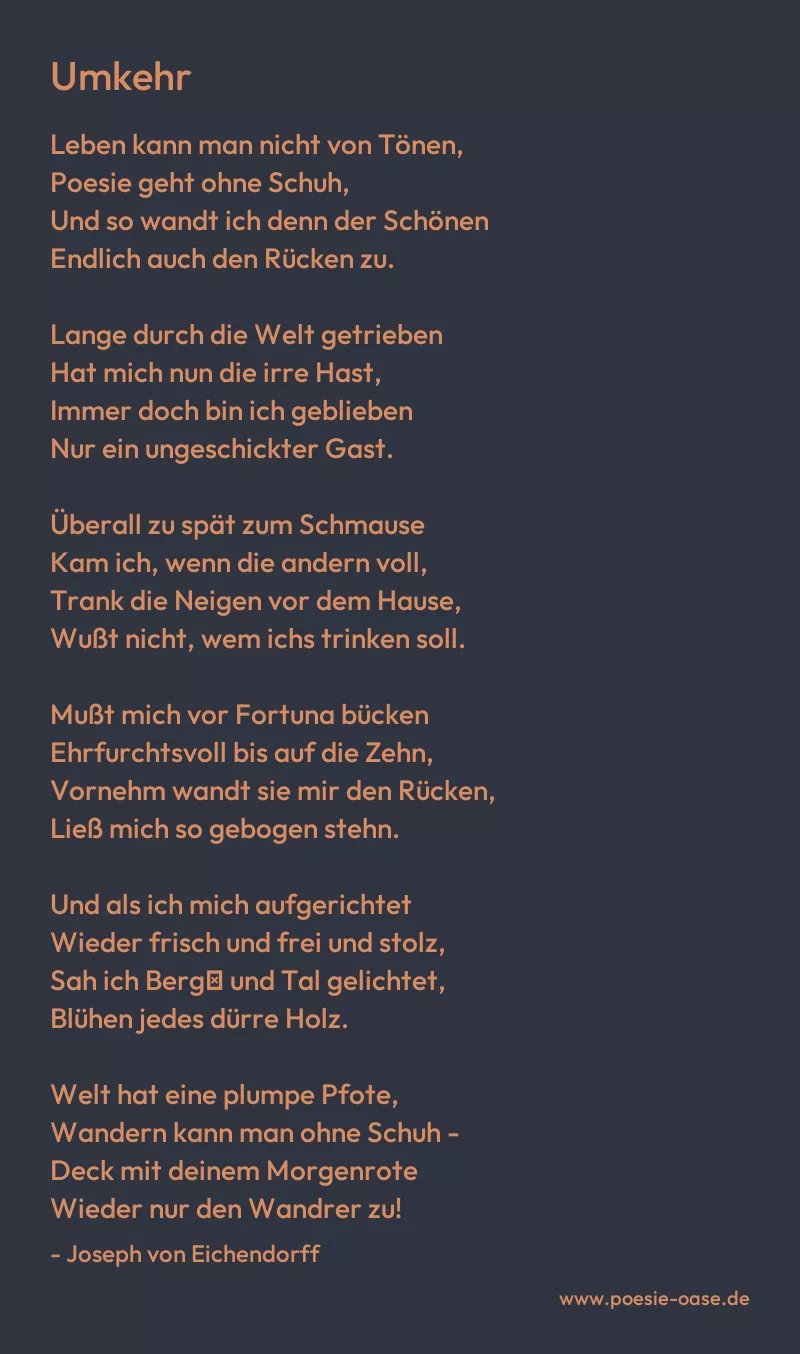Umkehr
Leben kann man nicht von Tönen,
Poesie geht ohne Schuh,
Und so wandt ich denn der Schönen
Endlich auch den Rücken zu.
Lange durch die Welt getrieben
Hat mich nun die irre Hast,
Immer doch bin ich geblieben
Nur ein ungeschickter Gast.
Überall zu spät zum Schmause
Kam ich, wenn die andern voll,
Trank die Neigen vor dem Hause,
Wußt nicht, wem ichs trinken soll.
Mußt mich vor Fortuna bücken
Ehrfurchtsvoll bis auf die Zehn,
Vornehm wandt sie mir den Rücken,
Ließ mich so gebogen stehn.
Und als ich mich aufgerichtet
Wieder frisch und frei und stolz,
Sah ich Berg′ und Tal gelichtet,
Blühen jedes dürre Holz.
Welt hat eine plumpe Pfote,
Wandern kann man ohne Schuh –
Deck mit deinem Morgenrote
Wieder nur den Wandrer zu!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
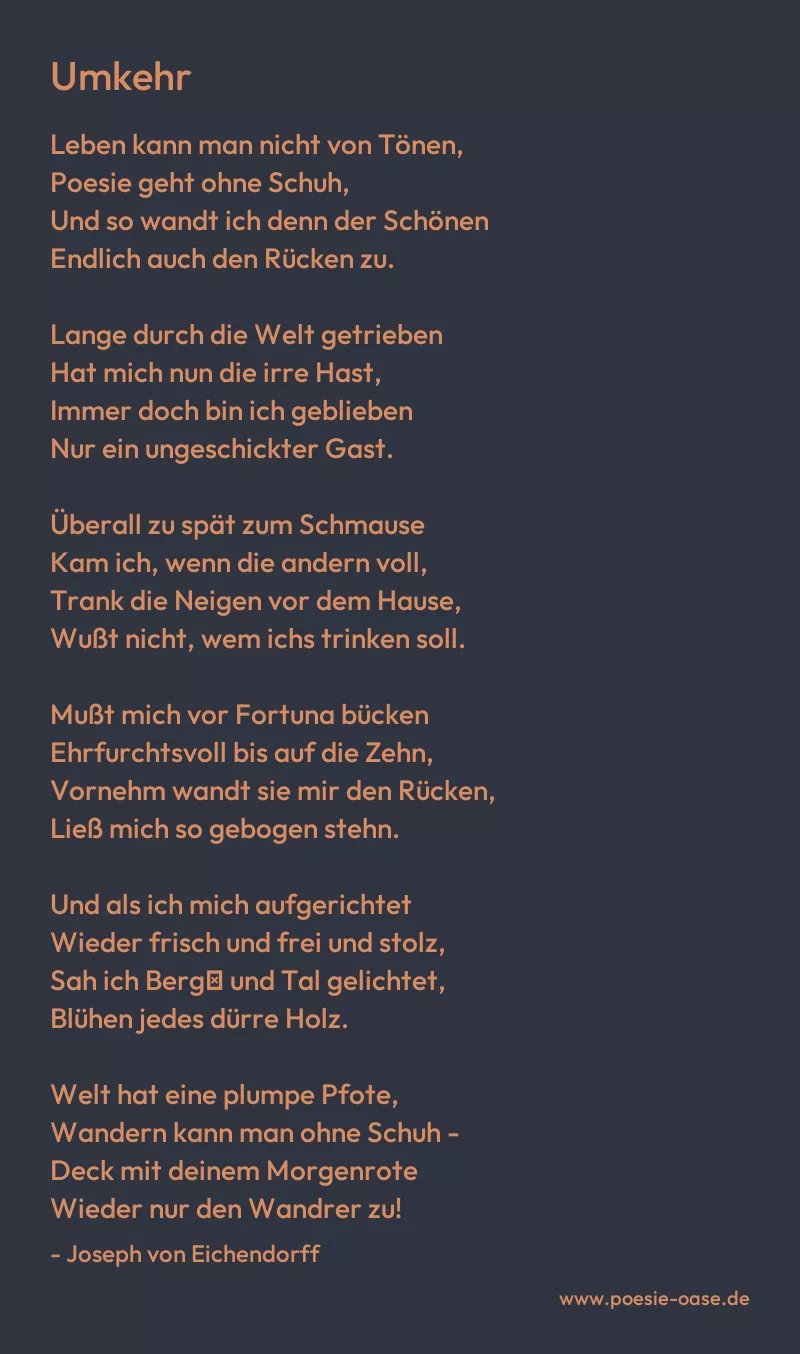
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Umkehr“ von Joseph von Eichendorff reflektiert eine Erfahrung der Enttäuschung und des Wandels, die in einer Rückbesinnung auf einfachere, authentischere Werte mündet. Der Titel deutet bereits die zentrale Thematik an: eine Abkehr von bestimmten Lebensweisen und eine Hinwendung zu neuen Perspektiven. Eichendorff nutzt eine vergleichsweise einfache Sprache, um seine komplexen Gefühle und Erkenntnisse auszudrücken. Die Verse folgen einem klaren Reimschema und einem rhythmischen Aufbau, was dem Gedicht eine gewisse Leichtigkeit verleiht, obwohl der Inhalt eine tiefe innere Auseinandersetzung thematisiert.
Der erste Teil des Gedichts, insbesondere die ersten beiden Strophen, beschreibt eine Lebensweise, die von unerfüllten Sehnsüchten und dem Scheitern am Glück geprägt ist. Der Dichter distanziert sich von der „Schönen“, was als Verzicht auf eine idealisierte, vielleicht übermäßig kunstvolle Lebensweise interpretiert werden kann. Er stellt fest, dass „Leben man nicht von Tönen“ und „Poesie geht ohne Schuh“, wodurch er die Notwendigkeit einer Rückkehr zur Realität und zum Wesentlichen andeutet. Die „irre Hast“, die ihn durch die Welt getrieben hat, lässt ihn letztendlich als „ungeschickten Gast“ zurück, was ein Gefühl der Fremdheit und des Nicht-Zugehörigkeitsgefühls widerspiegelt.
Die dritte und vierte Strophe verdeutlichen das Scheitern an der äußeren Welt und am Glück. Der Dichter fühlt sich stets zu spät am Ort des Genusses und ist nicht in der Lage, die Gabe des Glücks anzunehmen. Die Personifikation der Fortuna, die ihm den Rücken zukehrt, symbolisiert das Versagen in der Gesellschaft. Dieser Moment der Demütigung führt jedoch zu einem Wendepunkt. Durch die Erfahrung der Ablehnung und des Scheiterns wird eine neue Perspektive eröffnet, die in der fünften Strophe gipfelt.
Die letzte Strophe zeigt die transformative Wirkung des Umdenkens. Die Enttäuschungen weichen einer neu gewonnenen Freiheit und einer positiven Wahrnehmung der Welt. Die Sicht auf die Natur, mit den „Berg′ und Tal gelichtet“ und dem „Blühen jedes dürren Holz“, symbolisiert die Wiederentdeckung von Schönheit und Hoffnung. Der Appell an das „Morgenrot“, den „Wandrer“ zu decken, steht für den Wunsch nach Schutz, Geborgenheit und einer einfachen, natürlichen Existenz, die frei von den Zwängen und Enttäuschungen der Welt ist. Die „plumpe Pfote“ der Welt wird als etwas erkannt, das überwunden werden kann, indem man sich von den äußeren Ansprüchen befreit und zu den eigenen, inneren Werten zurückkehrt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.