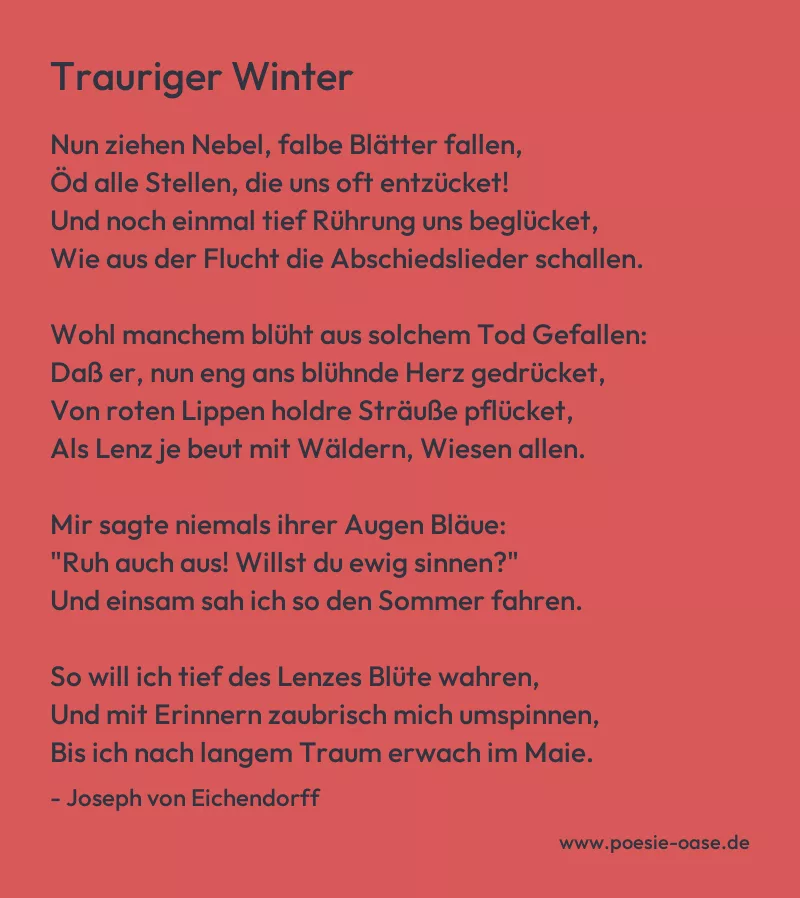Trauriger Winter
Nun ziehen Nebel, falbe Blätter fallen,
Öd alle Stellen, die uns oft entzücket!
Und noch einmal tief Rührung uns beglücket,
Wie aus der Flucht die Abschiedslieder schallen.
Wohl manchem blüht aus solchem Tod Gefallen:
Daß er, nun eng ans blühnde Herz gedrücket,
Von roten Lippen holdre Sträuße pflücket,
Als Lenz je beut mit Wäldern, Wiesen allen.
Mir sagte niemals ihrer Augen Bläue:
„Ruh auch aus! Willst du ewig sinnen?“
Und einsam sah ich so den Sommer fahren.
So will ich tief des Lenzes Blüte wahren,
Und mit Erinnern zaubrisch mich umspinnen,
Bis ich nach langem Traum erwach im Maie.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
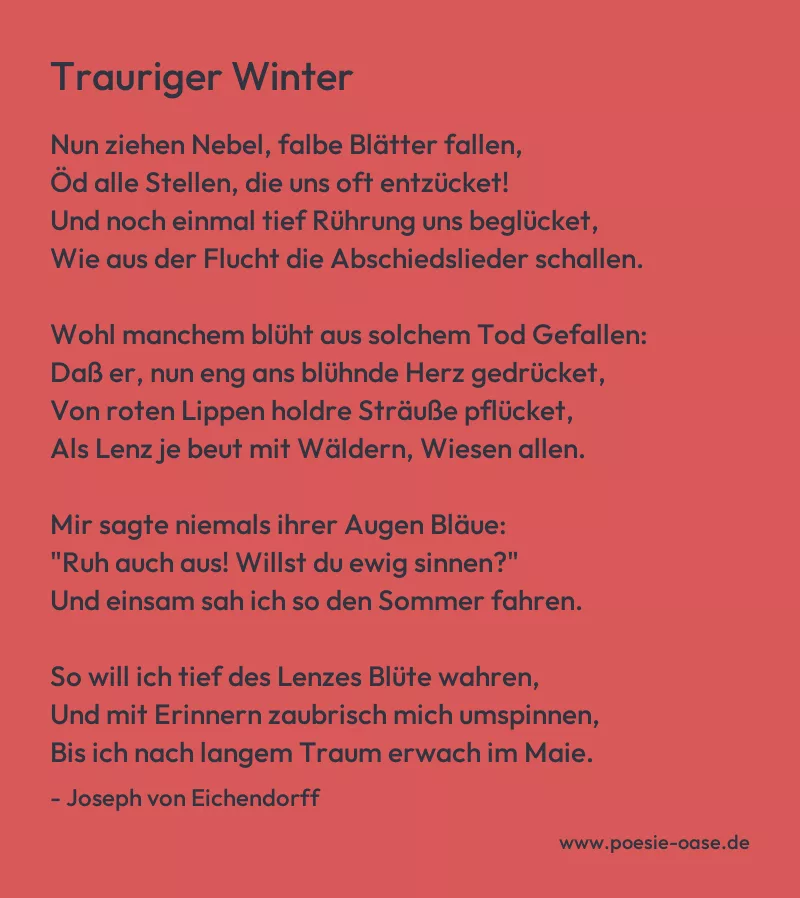
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Trauriger Winter“ von Joseph von Eichendorff beschreibt die melancholische Stimmung des Herbstes und die Sehnsucht nach dem Frühling. Der erste Teil des Gedichts, die ersten vier Verse, etabliert die Szenerie des Winters mit den fallenden Blättern und der trüben Nebelstimmung, die alle Orte, die einst Freude bereiteten, nun verlassen und öde erscheinen lässt. Die Zeilen beschwören eine Atmosphäre der Abschiednahme und des Verfalls, was durch die Bilder der flüchtenden „Abschiedslieder“ verstärkt wird. Diese Eröffnung setzt den Grundton für das gesamte Gedicht und bereitet den Leser auf die kommende Kontemplation vor.
Der zweite Teil, die nächsten vier Verse, führt einen Kontrast ein. Es wird die Möglichkeit des Trostes und des neuen Lebens, das aus dem Tod des Sommers entspringt, angedeutet. Dies geschieht durch das Bild der Liebe und der Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Der Dichter spricht von denen, die in dieser Zeit des Übergangs Trost finden und in der Liebe Trost und Glück erfahren. Die „roten Lippen“ und die „holdre Sträuße“ symbolisieren die Freuden der Liebe, die scheinbar größer sind als alles, was der Frühling bieten kann. Dieser Teil des Gedichts deutet auf die persönliche Traurigkeit des Sprechers hin, da er selbst diese Freuden nicht erlebt hat.
In den letzten vier Versen wird die persönliche Traurigkeit des Sprechers deutlicher. Er reflektiert über seine Einsamkeit und die unerfüllte Sehnsucht nach Liebe. Die „Bläue“ ihrer Augen, die nie sagte: „Ruh auch aus! Willst du ewig sinnen?“ verdeutlicht die Enttäuschung und das Gefühl der Isolation. Der Sprecher hat den Sommer und damit die Zeit der Liebe und Freude verpasst, ohne jemals dieses Glück erfahren zu haben. Er entscheidet sich jedoch, die Erinnerungen an den Frühling zu bewahren und sich in diese Erinnerungen zu flüchten.
Der Schlussteil des Gedichts deutet auf die Hoffnung auf eine Wiedergeburt und die Wiederkehr des Frühlings. Indem er sich in Erinnerungen „zaubrisch umspinnt“, bewahrt der Sprecher die Hoffnung auf einen Neubeginn und eine neue Blütezeit. Die Zeile „Bis ich nach langem Traum erwach im Maie“ verspricht eine Zeit der Erneuerung und des Erwachens, was die trübe Winterstimmung in eine Vision der Hoffnung und des Neubeginns transformiert. Das Gedicht ist somit eine Reflexion über die Vergänglichkeit des Lebens, die Sehnsucht nach Liebe und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.