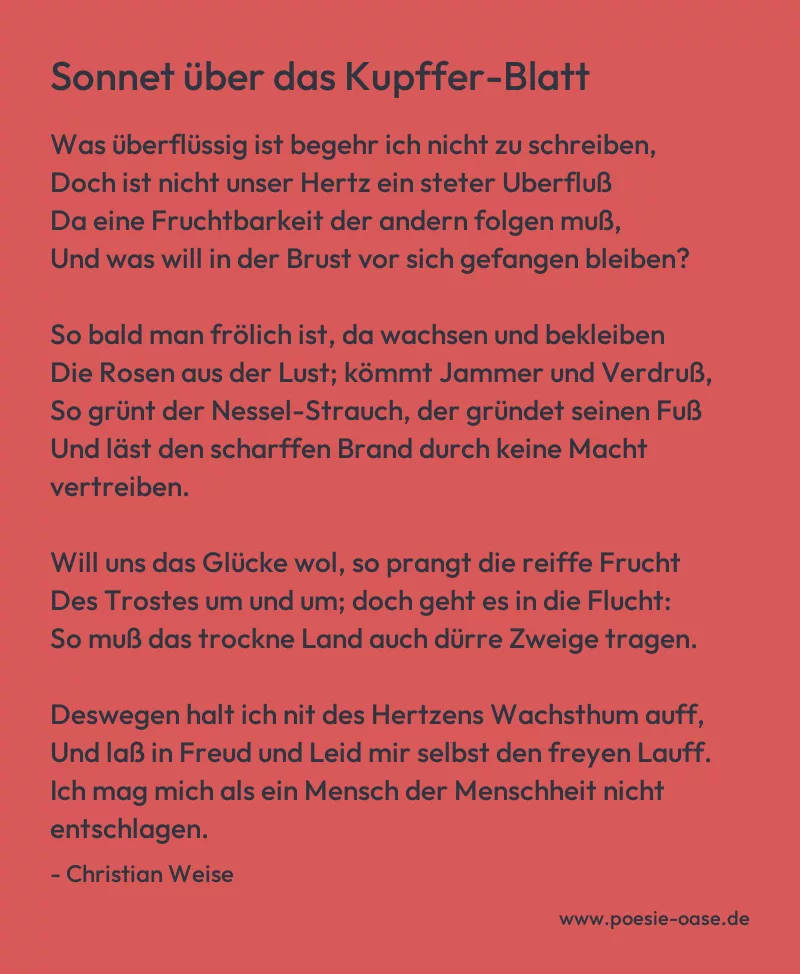Sonnet über das Kupffer-Blatt
Was überflüssig ist begehr ich nicht zu schreiben,
Doch ist nicht unser Hertz ein steter Uberfluß
Da eine Fruchtbarkeit der andern folgen muß,
Und was will in der Brust vor sich gefangen bleiben?
So bald man frölich ist, da wachsen und bekleiben
Die Rosen aus der Lust; kömmt Jammer und Verdruß,
So grünt der Nessel-Strauch, der gründet seinen Fuß
Und läst den scharffen Brand durch keine Macht vertreiben.
Will uns das Glücke wol, so prangt die reiffe Frucht
Des Trostes um und um; doch geht es in die Flucht:
So muß das trockne Land auch dürre Zweige tragen.
Deswegen halt ich nit des Hertzens Wachsthum auff,
Und laß in Freud und Leid mir selbst den freyen Lauff.
Ich mag mich als ein Mensch der Menschheit nicht entschlagen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
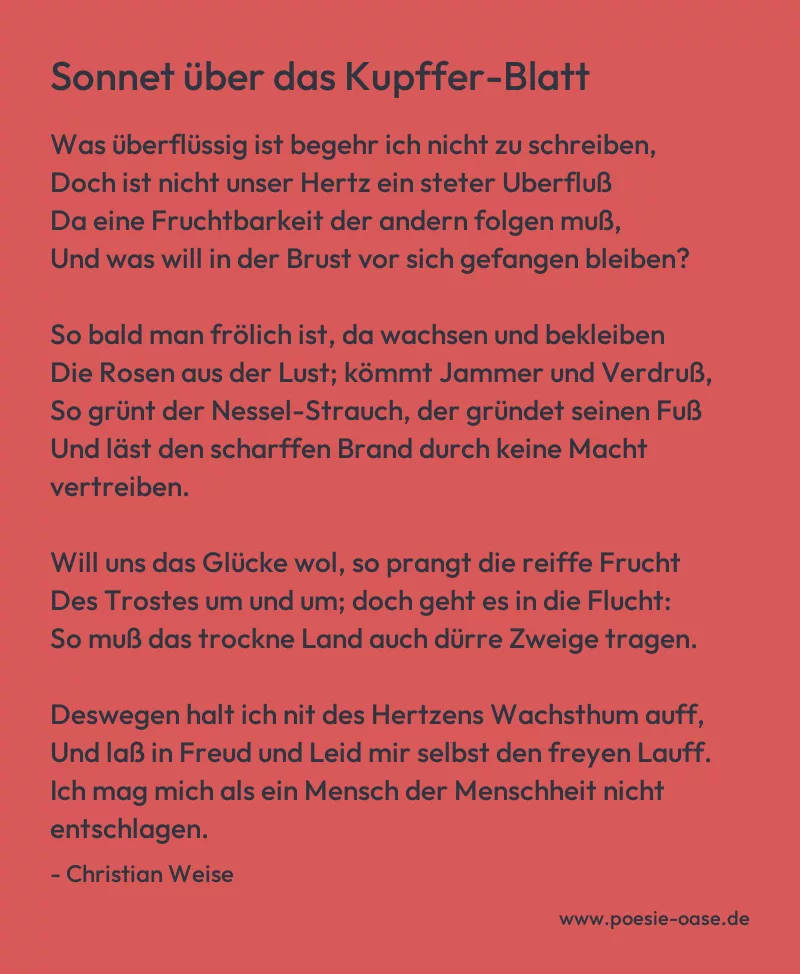
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sonnet über das Kupffer-Blatt“ von Christian Weise ist eine Reflexion über die Natur des menschlichen Herzens und die unaufhaltsamen Schwankungen von Freude und Leid. Es greift die Idee auf, dass das Herz, wie eine Pflanze, in ständiger Veränderung und Wachstum begriffen ist, geprägt von der unaufhörlichen Abfolge von positiven und negativen Emotionen. Die Metapher des Kupferblattes, das sich im Gedicht findet, deutet auf die Vergänglichkeit und die stetige Transformation hin, die auch das menschliche Erleben kennzeichnet.
Das Gedicht beginnt mit dem Eingeständnis, dass der Autor Überflüssiges vermeiden möchte, doch sofort wird die Frage aufgeworfen, ob das Herz nicht selbst ein ständiger Überfluss sei, ein Ort, an dem Emotionen wie Früchte aufeinanderfolgen und sich entfalten. Die Bilder von Rosen der Freude und Nessel-Sträuchern des Jammers visualisieren die beiden Pole des menschlichen Erlebens. Diese Gegensätze verdeutlichen die Dualität des Lebens, die Unvermeidbarkeit sowohl von Glück als auch von Unglück. Der „scharffe Brand“ der Nesseln, der sich nicht vertreiben lässt, unterstreicht die tiefgreifende Wirkung von negativen Gefühlen.
In der Folge wird die Vergänglichkeit des Glücks thematisiert. Die „reiffe Frucht“ des Trostes, die in Zeiten des Glücks um das Herz „prangt“, muss dem Bild des „dürren Zweige“ weichen, wenn sich das Glück in die Flucht begibt. Diese Metapher unterstreicht die Flüchtigkeit des Glücks und die Notwendigkeit, sich mit den wechselnden Gezeiten des Lebens zu arrangieren. Der abschließende Teil des Gedichts ist eine Art Fazit, eine Ermutigung zur Akzeptanz der eigenen Gefühle und zur Hingabe an den natürlichen Lauf des Lebens.
Die letzten beiden Verse stellen die Quintessenz des Sonetts dar. Der Autor entscheidet sich, dem Wachstum des Herzens nicht Einhalt zu gebieten und erlaubt sich selbst, sowohl in Freude als auch in Leid seinen „freyen Lauff“ zu nehmen. Die abschließende Zeile „Ich mag mich als ein Mensch der Menschheit nicht entschlagen.“ bekräftigt die Akzeptanz der eigenen Menschlichkeit mit all ihren Facetten. Damit wird die unumgängliche Verbundenheit mit dem menschlichen Dasein und der Erfahrung von Emotionen betont, als ein wesentlicher Aspekt des Lebens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.