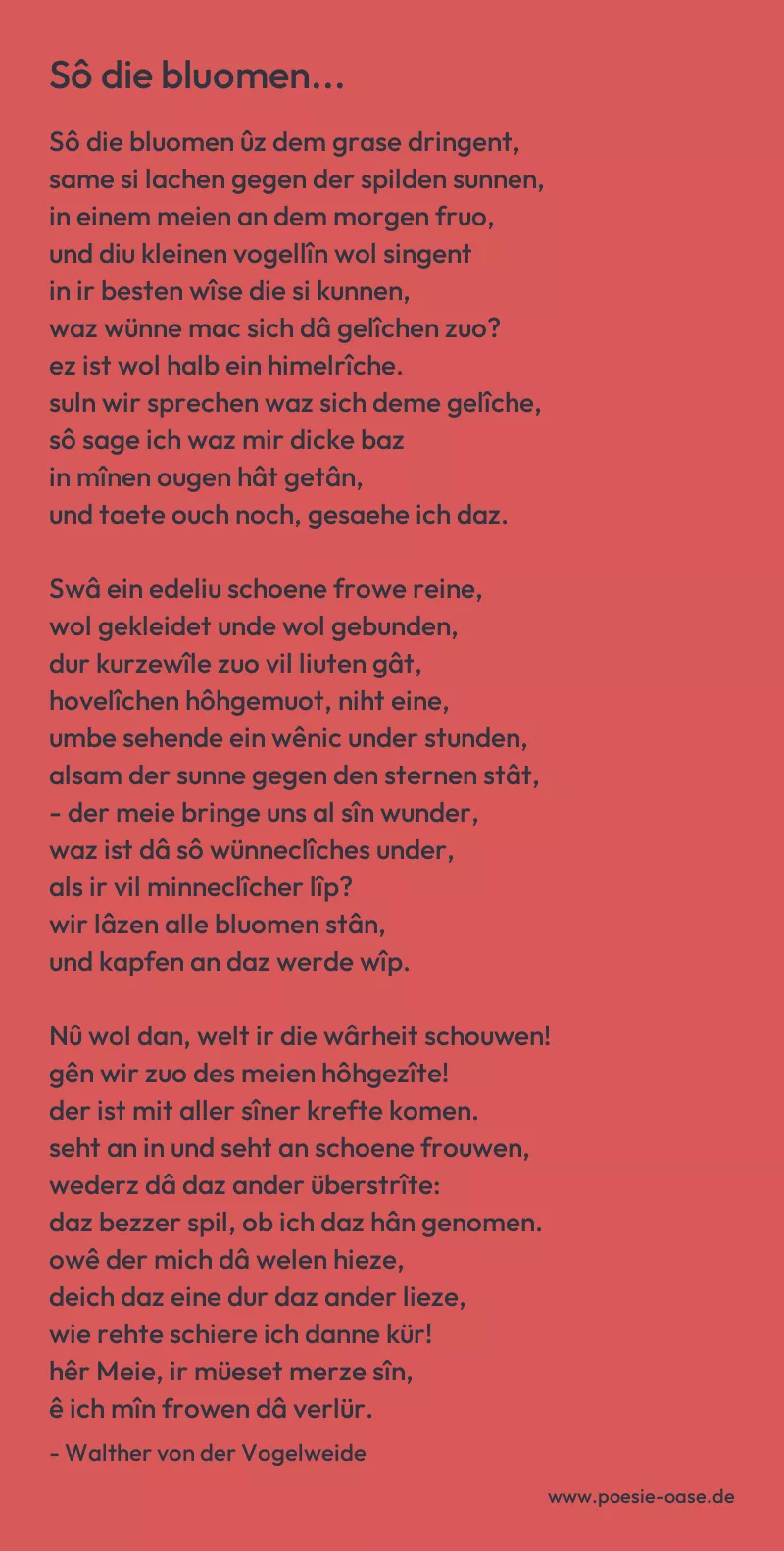Sô die bluomen…
Sô die bluomen ûz dem grase dringent,
same si lachen gegen der spilden sunnen,
in einem meien an dem morgen fruo,
und diu kleinen vogellîn wol singent
in ir besten wîse die si kunnen,
waz wünne mac sich dâ gelîchen zuo?
ez ist wol halb ein himelrîche.
suln wir sprechen waz sich deme gelîche,
sô sage ich waz mir dicke baz
in mînen ougen hât getân,
und taete ouch noch, gesaehe ich daz.
Swâ ein edeliu schoene frowe reine,
wol gekleidet unde wol gebunden,
dur kurzewîle zuo vil liuten gât,
hovelîchen hôhgemuot, niht eine,
umbe sehende ein wênic under stunden,
alsam der sunne gegen den sternen stât,
– der meie bringe uns al sîn wunder,
waz ist dâ sô wünneclîches under,
als ir vil minneclîcher lîp?
wir lâzen alle bluomen stân,
und kapfen an daz werde wîp.
Nû wol dan, welt ir die wârheit schouwen!
gên wir zuo des meien hôhgezîte!
der ist mit aller sîner krefte komen.
seht an in und seht an schoene frouwen,
wederz dâ daz ander überstrîte:
daz bezzer spil, ob ich daz hân genomen.
owê der mich dâ welen hieze,
deich daz eine dur daz ander lieze,
wie rehte schiere ich danne kür!
hêr Meie, ir müeset merze sîn,
ê ich mîn frowen dâ verlür.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
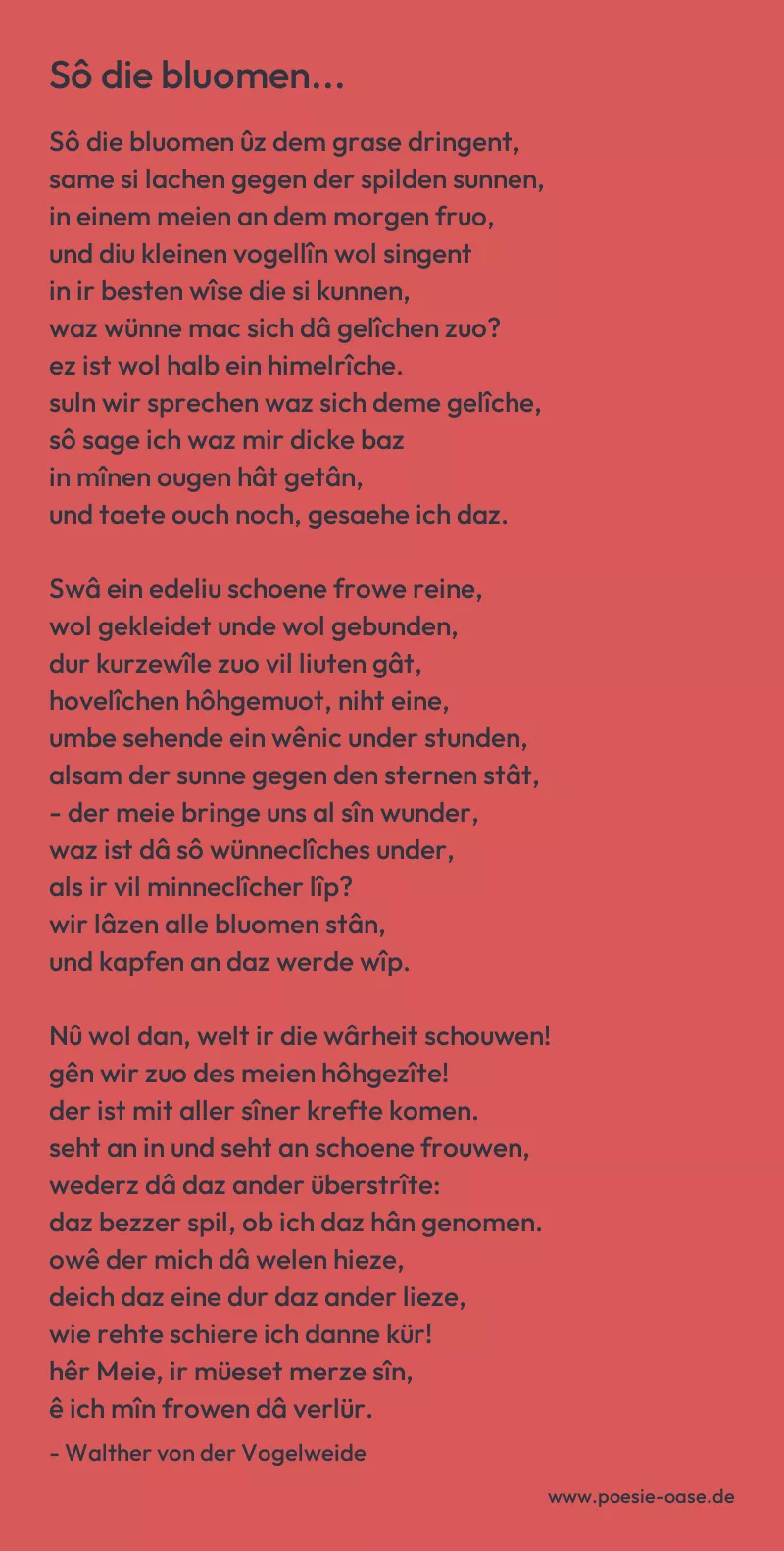
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sô die bluomen…“ von Walther von der Vogelweide ist eine Ode an die Schönheit und die Freuden des Frühlings, wobei die Natur und die menschliche Schönheit, insbesondere die einer edlen Frau, in einen direkten Vergleich gesetzt werden. Das Gedicht beginnt mit einer lebendigen Beschreibung der Natur, insbesondere der blühenden Blumen und der singenden Vögel im Morgengrauen. Diese Szenerie wird als „halb ein himelrîche“ bezeichnet, was die paradiesische Qualität der Natur hervorhebt. Der Dichter stellt jedoch im weiteren Verlauf die Frage, was dieser Idylle ebenbürtig sei, und die Antwort offenbart sich in der Präsentation einer „edeliu schoene frowe reine“, die in all ihrer Anmut und Eleganz inmitten der Menge wandelt.
In der zweiten Strophe lenkt der Dichter die Aufmerksamkeit auf diese Frau, die mit ihrer Schönheit und ihrem Stolz die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er beschreibt sie als „wol gekleidet unde wol gebunden“, was auf ihre kultivierte Erscheinung hindeutet. Ihr Anblick wird mit der Sonne verglichen, die zwischen den Sternen steht, was ihre erhabene Schönheit unterstreicht. Die Beschreibung der Frau ist detailliert und voller Bewunderung, wobei der Dichter ihre „minneclîcher lîp“ (liebenswürdiger Körper) hervorhebt. Er scheint sich von der Anziehungskraft der Frau so sehr vereinnahmt zu fühlen, dass er die Schönheit der Natur, die er zuvor beschworen hat, zugunsten der Frau zurückstellt.
Die dritte Strophe offenbart die zentrale Frage des Gedichts: Was übertrifft die Schönheit des Frühlings? Walther von der Vogelweide stellt die Frage, ob die Schönheit des Frühlings oder die einer schönen Frau höher zu bewerten ist. Er beschreibt den Frühling als „hôhgezîte“, ein Fest der Erneuerung und des Lebens, und fordert seine Leser auf, die Natur und die Frau zu vergleichen. Er bekennt, dass er, wenn er sich zwischen den beiden entscheiden müsste, die Frau wählen würde, da er ihren Verlust fürchten würde.
Die abschließenden Verse zeigen die Liebe und Wertschätzung des Dichters für die Dame. Er möchte sie auf keinen Fall verlieren und wünscht dem Frühling selbst „merze sîn“ (müssen warten), bevor er seine „frowen“ verliert. Dies zeigt, dass für den Dichter die menschliche Schönheit und die Liebe über der Schönheit der Natur stehen. Die abschließende Zeile unterstreicht die starke emotionale Verbindung des Dichters zu der Dame, wodurch das Gedicht eine tiefere menschliche Erfahrung zum Ausdruck bringt. Das Gedicht feiert somit die Freude am Leben, die Schönheit der Natur und die Macht der Liebe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.