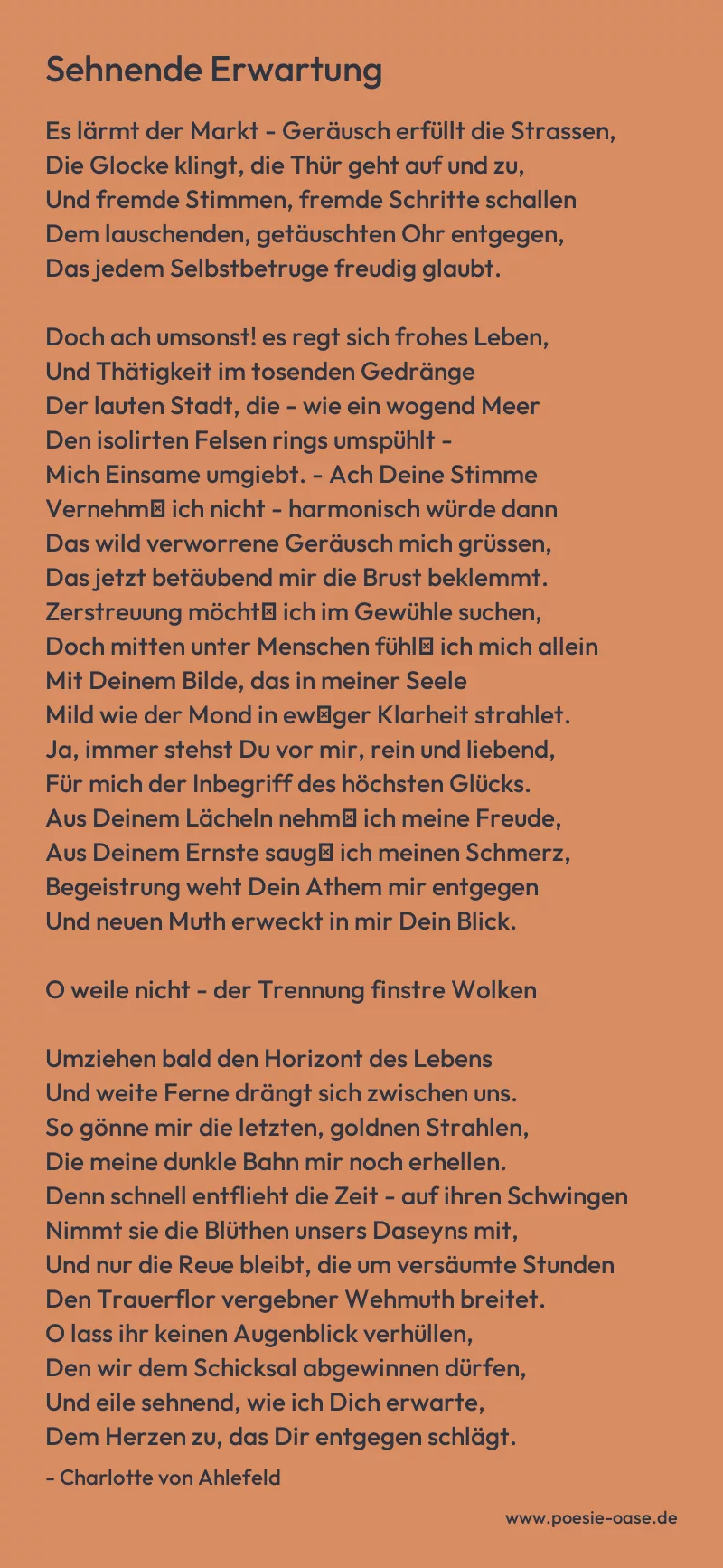Es lärmt der Markt – Geräusch erfüllt die Strassen,
Die Glocke klingt, die Thür geht auf und zu,
Und fremde Stimmen, fremde Schritte schallen
Dem lauschenden, getäuschten Ohr entgegen,
Das jedem Selbstbetruge freudig glaubt.
Doch ach umsonst! es regt sich frohes Leben,
Und Thätigkeit im tosenden Gedränge
Der lauten Stadt, die – wie ein wogend Meer
Den isolirten Felsen rings umspühlt –
Mich Einsame umgiebt. – Ach Deine Stimme
Vernehm′ ich nicht – harmonisch würde dann
Das wild verworrene Geräusch mich grüssen,
Das jetzt betäubend mir die Brust beklemmt.
Zerstreuung möcht′ ich im Gewühle suchen,
Doch mitten unter Menschen fühl′ ich mich allein
Mit Deinem Bilde, das in meiner Seele
Mild wie der Mond in ew′ger Klarheit strahlet.
Ja, immer stehst Du vor mir, rein und liebend,
Für mich der Inbegriff des höchsten Glücks.
Aus Deinem Lächeln nehm′ ich meine Freude,
Aus Deinem Ernste saug′ ich meinen Schmerz,
Begeistrung weht Dein Athem mir entgegen
Und neuen Muth erweckt in mir Dein Blick.
O weile nicht – der Trennung finstre Wolken
Umziehen bald den Horizont des Lebens
Und weite Ferne drängt sich zwischen uns.
So gönne mir die letzten, goldnen Strahlen,
Die meine dunkle Bahn mir noch erhellen.
Denn schnell entflieht die Zeit – auf ihren Schwingen
Nimmt sie die Blüthen unsers Daseyns mit,
Und nur die Reue bleibt, die um versäumte Stunden
Den Trauerflor vergebner Wehmuth breitet.
O lass ihr keinen Augenblick verhüllen,
Den wir dem Schicksal abgewinnen dürfen,
Und eile sehnend, wie ich Dich erwarte,
Dem Herzen zu, das Dir entgegen schlägt.