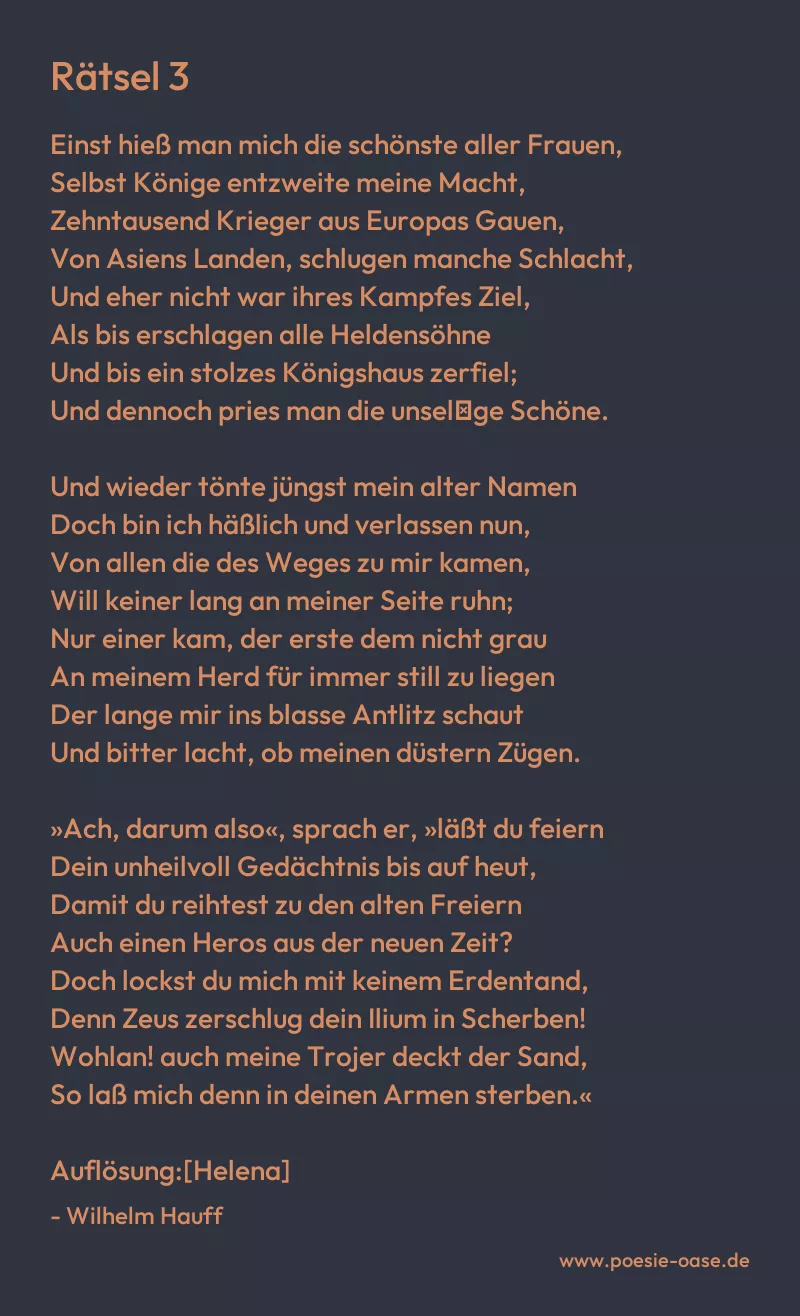Rätsel 3
Einst hieß man mich die schönste aller Frauen,
Selbst Könige entzweite meine Macht,
Zehntausend Krieger aus Europas Gauen,
Von Asiens Landen, schlugen manche Schlacht,
Und eher nicht war ihres Kampfes Ziel,
Als bis erschlagen alle Heldensöhne
Und bis ein stolzes Königshaus zerfiel;
Und dennoch pries man die unsel′ge Schöne.
Und wieder tönte jüngst mein alter Namen
Doch bin ich häßlich und verlassen nun,
Von allen die des Weges zu mir kamen,
Will keiner lang an meiner Seite ruhn;
Nur einer kam, der erste dem nicht grau
An meinem Herd für immer still zu liegen
Der lange mir ins blasse Antlitz schaut
Und bitter lacht, ob meinen düstern Zügen.
»Ach, darum also«, sprach er, »läßt du feiern
Dein unheilvoll Gedächtnis bis auf heut,
Damit du reihtest zu den alten Freiern
Auch einen Heros aus der neuen Zeit?
Doch lockst du mich mit keinem Erdentand,
Denn Zeus zerschlug dein Ilium in Scherben!
Wohlan! auch meine Trojer deckt der Sand,
So laß mich denn in deinen Armen sterben.«
Auflösung:[Helena]
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
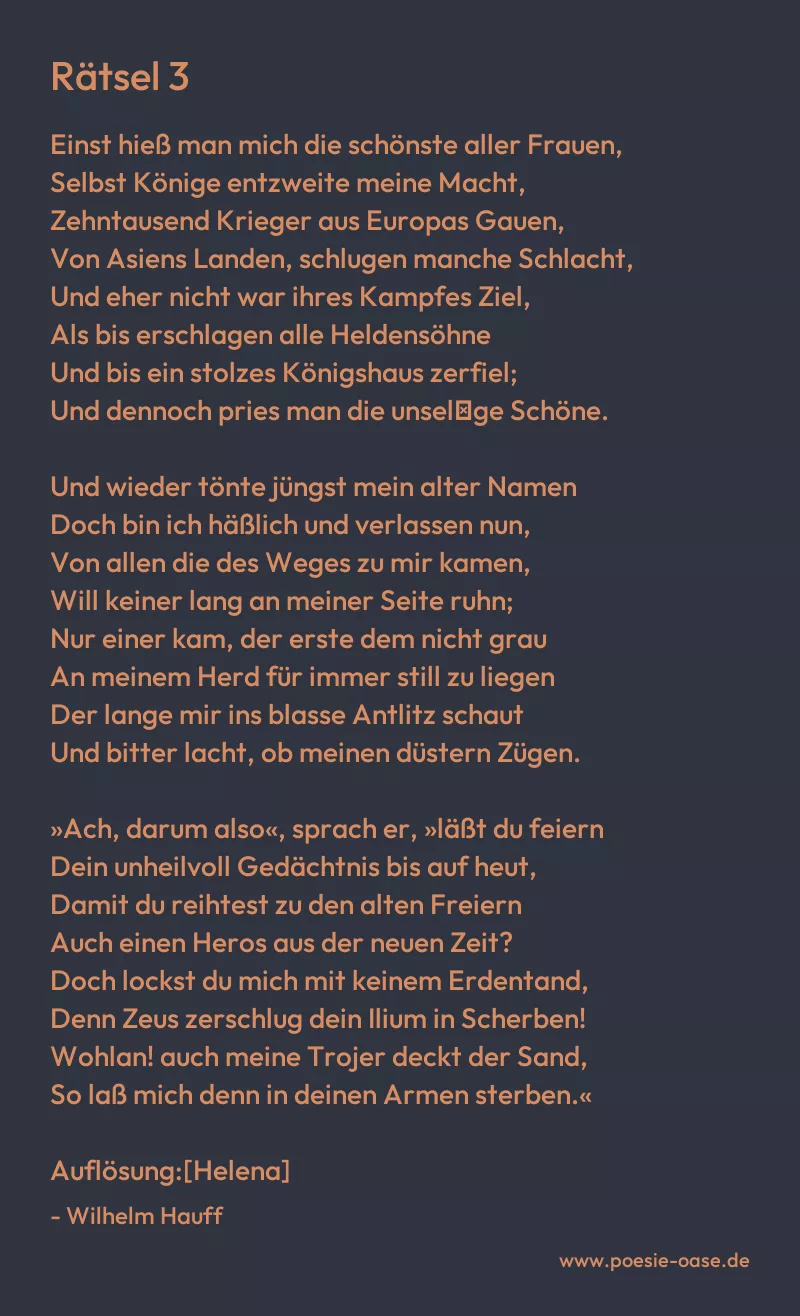
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Rätsel 3“ von Wilhelm Hauff präsentiert ein komplexes Rätsel, das sich um die Figur der Helena dreht. Die Struktur des Gedichts ist in drei Strophen unterteilt, wobei jede Strophe eine Facette der beschriebenen Person beleuchtet, um letztendlich die Identität der Rätselhaften zu enthüllen. Die Sprache ist gehoben und verwendet Elemente wie Metaphern und historische Anspielungen, um das Rätsel mit einer gewissen Ehrfurcht zu umkleiden.
In der ersten Strophe wird ein Bild der erhabenen Schönheit und Macht der rätselhaften Figur entworfen. Sie wird als „schönste aller Frauen“ bezeichnet, deren Schönheit Könige entzweite und Kriege auslöste. Die Zehntausende Krieger, die für sie kämpften, symbolisieren die verheerenden Auswirkungen ihrer bloßen Existenz. Die Beschreibung von Schlachten, Heldentaten und dem Untergang königlicher Häuser deutet unmissverständlich auf die historische Figur der Helena von Troja hin, deren Schönheit den Trojanischen Krieg auslöste. Hier wird ein Bild der Macht, Schönheit und Zerstörungskraft der Frau skizziert.
Die zweite Strophe vollzieht einen dramatischen Wandel. Die Schönheit, die einst Gegenstand des Krieges war, ist nun verflogen, und die Figur wird als „hässlich und verlassen“ beschrieben. Diejenigen, die einst ihre Nähe suchten, fliehen nun vor ihr. Die einzige Ausnahme ist eine einzelne Person, die sich dazu bereit erklärt, für immer an ihrer Seite zu verweilen, obwohl er ihre „düstern Züge“ betrachtet und bitter lacht. Dieser Kontrast zwischen einstiger Pracht und jetziger Verlassenheit unterstreicht die Vergänglichkeit von Ruhm und Schönheit und deutet auf das Schicksal der Helena hin, die nach dem Trojanischen Krieg in Vergessenheit geriet oder möglicherweise mit dem Alter konfrontiert wurde.
Die abschließende dritte Strophe beinhaltet die Lösung des Rätsels. Der letzte Freier, der die Schönheit der Frau erkannt hat, ist nun bereit, in ihren Armen zu sterben. Hier wird die Tragik der Helena noch einmal aufgeworfen, indem er auf das „unheilvoll Gedächtnis“ und die Vernichtung Trojas anspielt. Der Mann, der sich ihr nun zuwendet, erkennt die Wahrheit und akzeptiert das tragische Schicksal, das mit Helena verbunden ist. Er ist bereit, in ihren „Armen zu sterben“ und damit das Rätsel endgültig aufzulösen. Durch die Verwendung historischer Anspielungen und die Betonung von Tragik und Vergänglichkeit entwirft Hauff ein eindrucksvolles Portrait der Helena und ihrer Bedeutung in der Geschichte.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.