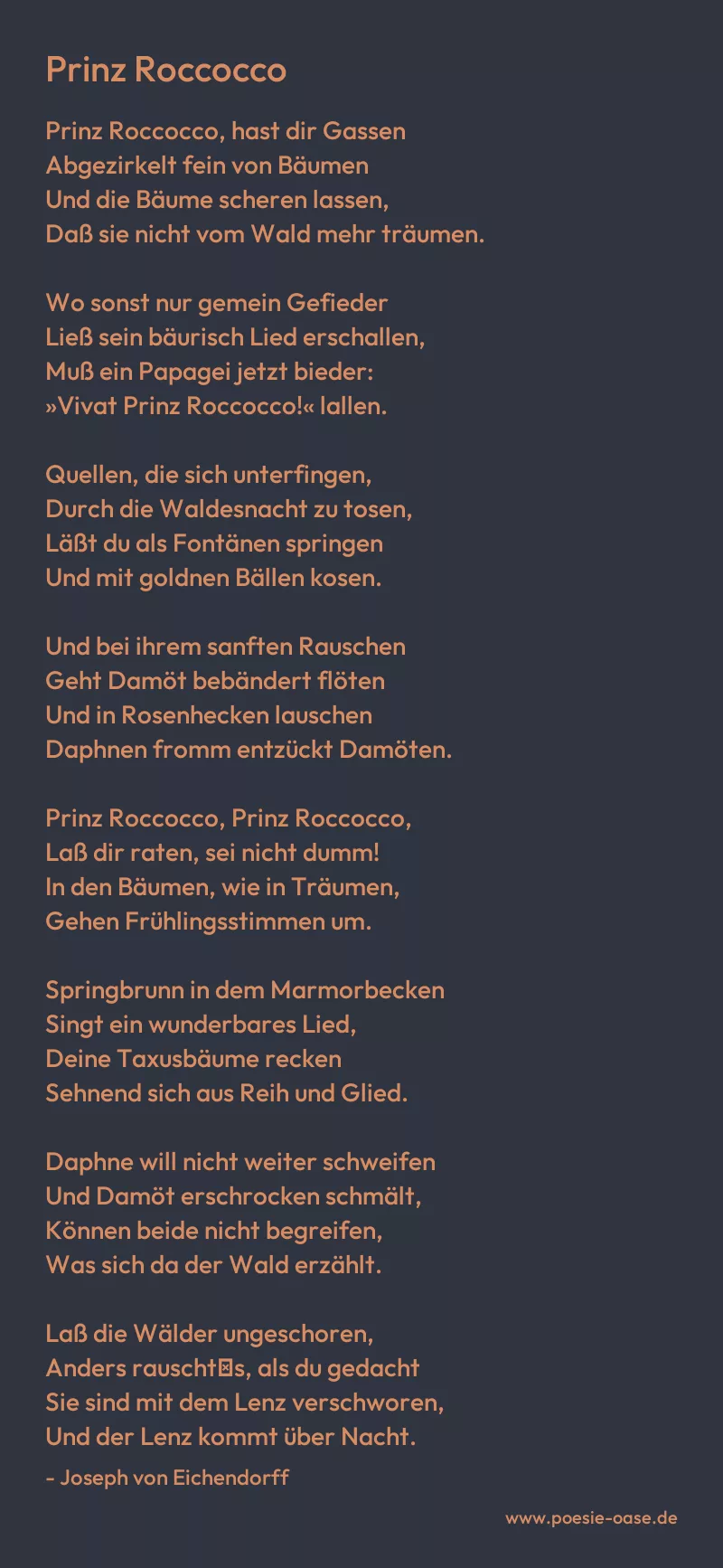Prinz Roccocco
Prinz Roccocco, hast dir Gassen
Abgezirkelt fein von Bäumen
Und die Bäume scheren lassen,
Daß sie nicht vom Wald mehr träumen.
Wo sonst nur gemein Gefieder
Ließ sein bäurisch Lied erschallen,
Muß ein Papagei jetzt bieder:
»Vivat Prinz Roccocco!« lallen.
Quellen, die sich unterfingen,
Durch die Waldesnacht zu tosen,
Läßt du als Fontänen springen
Und mit goldnen Bällen kosen.
Und bei ihrem sanften Rauschen
Geht Damöt bebändert flöten
Und in Rosenhecken lauschen
Daphnen fromm entzückt Damöten.
Prinz Roccocco, Prinz Roccocco,
Laß dir raten, sei nicht dumm!
In den Bäumen, wie in Träumen,
Gehen Frühlingsstimmen um.
Springbrunn in dem Marmorbecken
Singt ein wunderbares Lied,
Deine Taxusbäume recken
Sehnend sich aus Reih und Glied.
Daphne will nicht weiter schweifen
Und Damöt erschrocken schmält,
Können beide nicht begreifen,
Was sich da der Wald erzählt.
Laß die Wälder ungeschoren,
Anders rauscht′s, als du gedacht
Sie sind mit dem Lenz verschworen,
Und der Lenz kommt über Nacht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
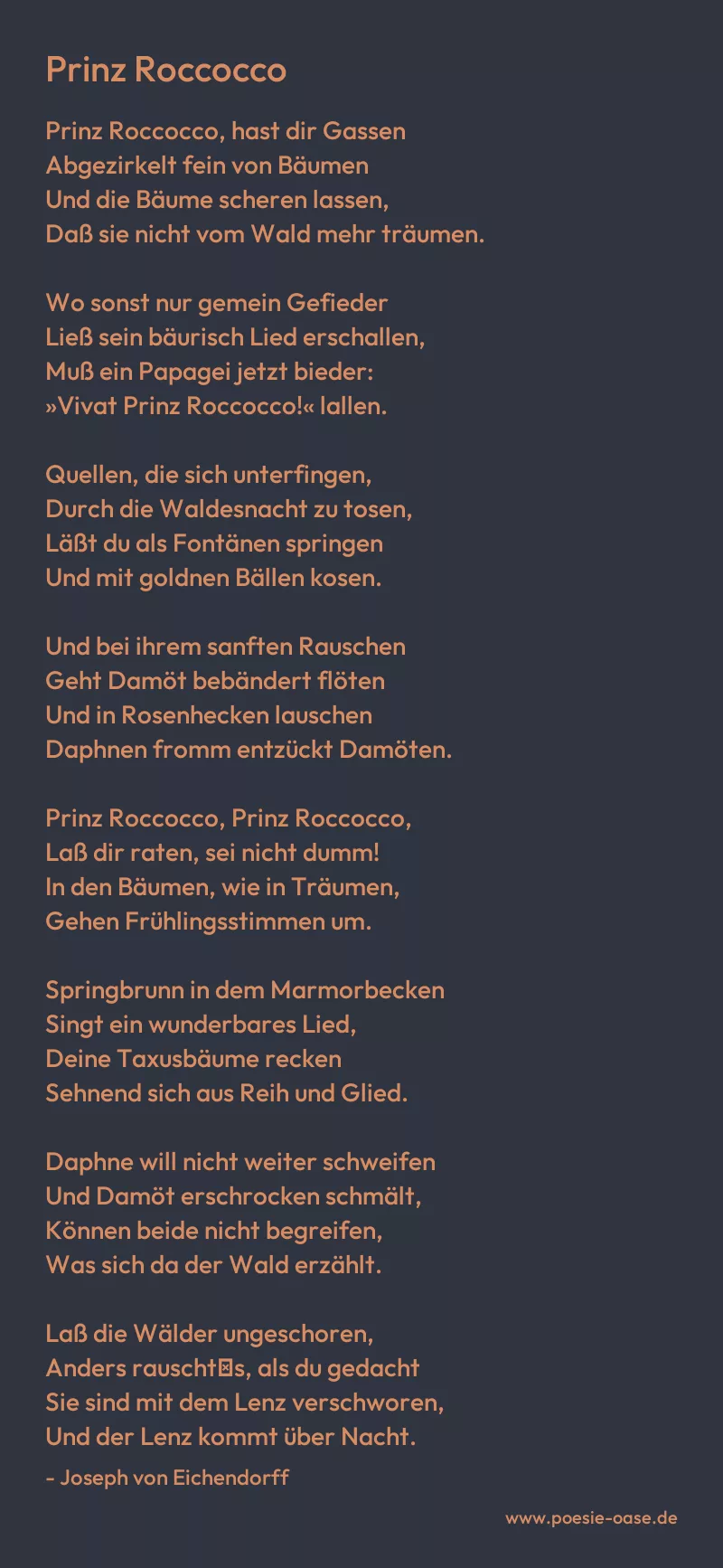
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Prinz Roccocco“ von Joseph von Eichendorff ist eine subtile Kritik an der Künstlichkeit und Begrenzung des menschlichen Strebens nach Kontrolle und Ordnung, dargestellt durch die Figur des Prinzen Roccocco. Es zeigt, wie der Prinz versucht, die Natur nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten und dabei die ursprüngliche Schönheit und Freiheit des Waldes zu zerstören. Die ersten vier Strophen beschreiben die Veränderungen, die der Prinz an der Natur vornimmt, von der Abzirkelung der Gassen bis zur Ersetzung des natürlichen Vogelgesangs durch die künstliche Nachahmung des Papageis. Diese Veränderungen symbolisieren den Versuch, die Natur zu domestizieren und zu unterwerfen, was letztendlich zu einer Verarmung führt.
Die zentralen Motive des Gedichts sind die Sehnsucht nach dem Ungebundenen und die Schönheit der Natur, die im Gegensatz zu der durch den Prinzen geschaffenen künstlichen Welt stehen. Der „Frühlingsstimmen“ und die „Wälder“, die im Laufe des Gedichts immer wieder auftauchen, repräsentieren die natürliche Ordnung und die ungezähmte Schönheit, die vom Prinzen vernachlässigt werden. Die zweite Hälfte des Gedichts, insbesondere die Strophen, in denen die „Taxusbäume“ sich sehnen und Daphne und Damöt die „Waldgeschichte“ nicht verstehen können, verstärken diesen Kontrast. Diese Elemente stehen für die Lebendigkeit und den Zauber der Natur, die der Prinz durch seine künstlichen Eingriffe zu unterdrücken versucht.
Die Kritik an der Selbstüberschätzung des Prinzen wird durch die Form des Gedichts unterstützt, das die traditionellen Elemente der Romantik aufgreift. Der sanfte Rhythmus und die bildreiche Sprache, die Eichendorff auszeichnet, verstärken die Wirkung der Botschaft. Die Wiederholung des Namens „Prinz Roccocco“ am Anfang und am Ende des Gedichts sowie die Warnung „Laß dir raten, sei nicht dumm!“ unterstreichen die moralische Botschaft und machen die Kritik an der künstlichen Welt des Prinzen noch deutlicher. Die letzten beiden Strophen sind ein Appell für die Freiheit und die Schönheit der Natur.
Die Figuren Daphne und Damöt dienen als Spiegelbild des Prinzen und zeigen dessen Unfähigkeit, die tiefere Bedeutung der Natur zu erfassen. Ihre Verwirrung über die „Waldgeschichte“ verdeutlicht die Kluft zwischen der künstlichen Welt des Prinzen und der natürlichen Welt, die für sie unverständlich geworden ist. Das Gedicht zeigt somit, dass die wahre Schönheit und Freude in der unberührten Natur zu finden sind, und dass das Streben nach Kontrolle und Ordnung letztendlich zu einer Entfremdung von dieser ursprünglichen Schönheit führt. Es ist eine Warnung vor der Begrenzung der menschlichen Vorstellungskraft und eine Hommage an die unerschöpfliche Fülle der Natur.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.