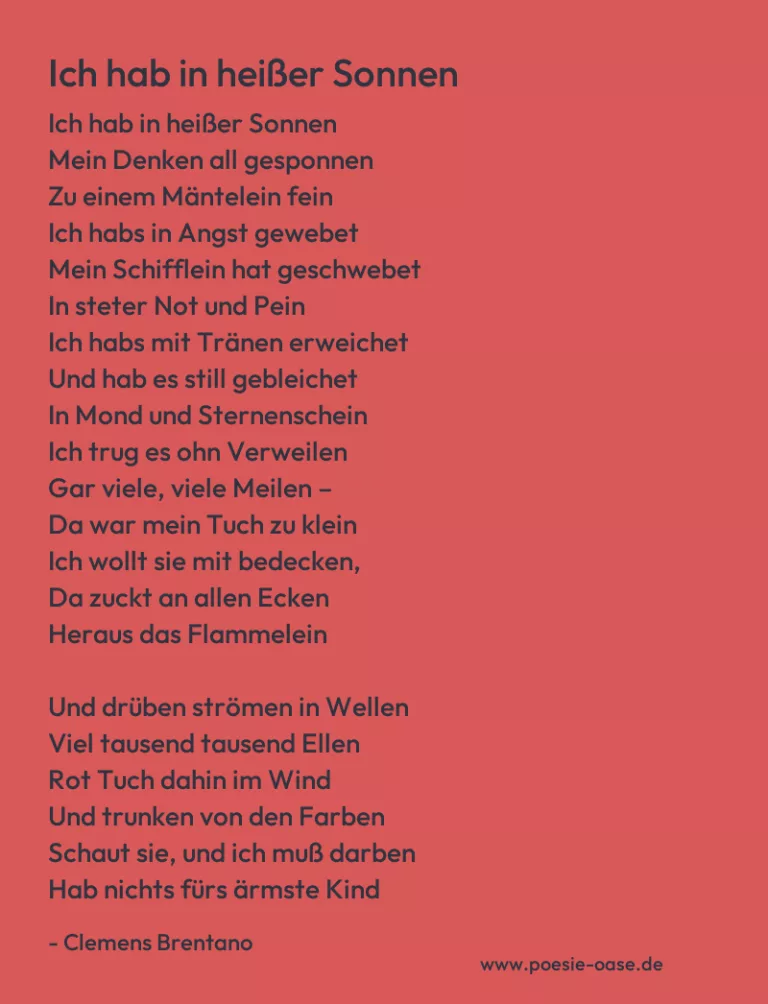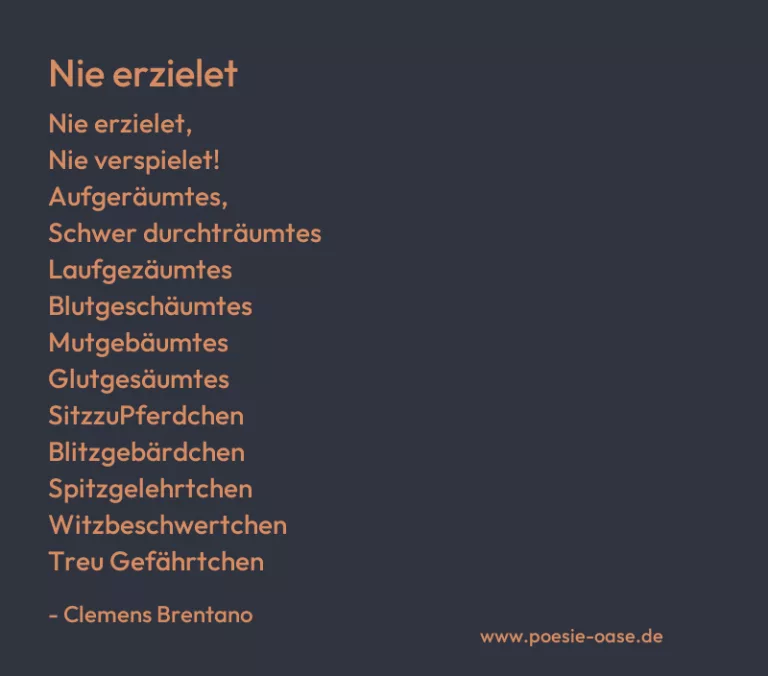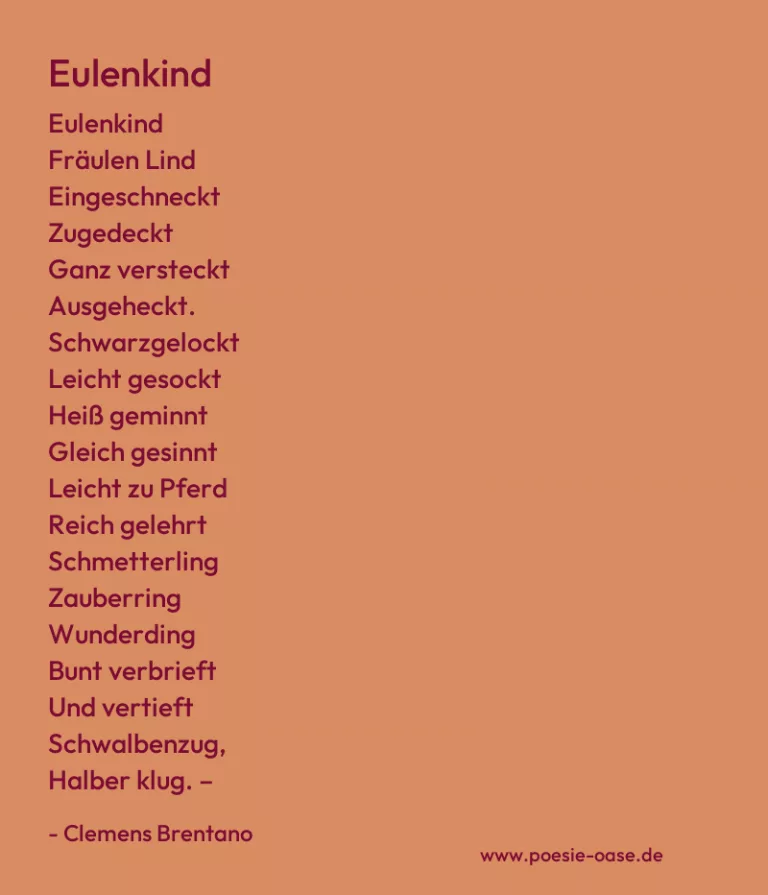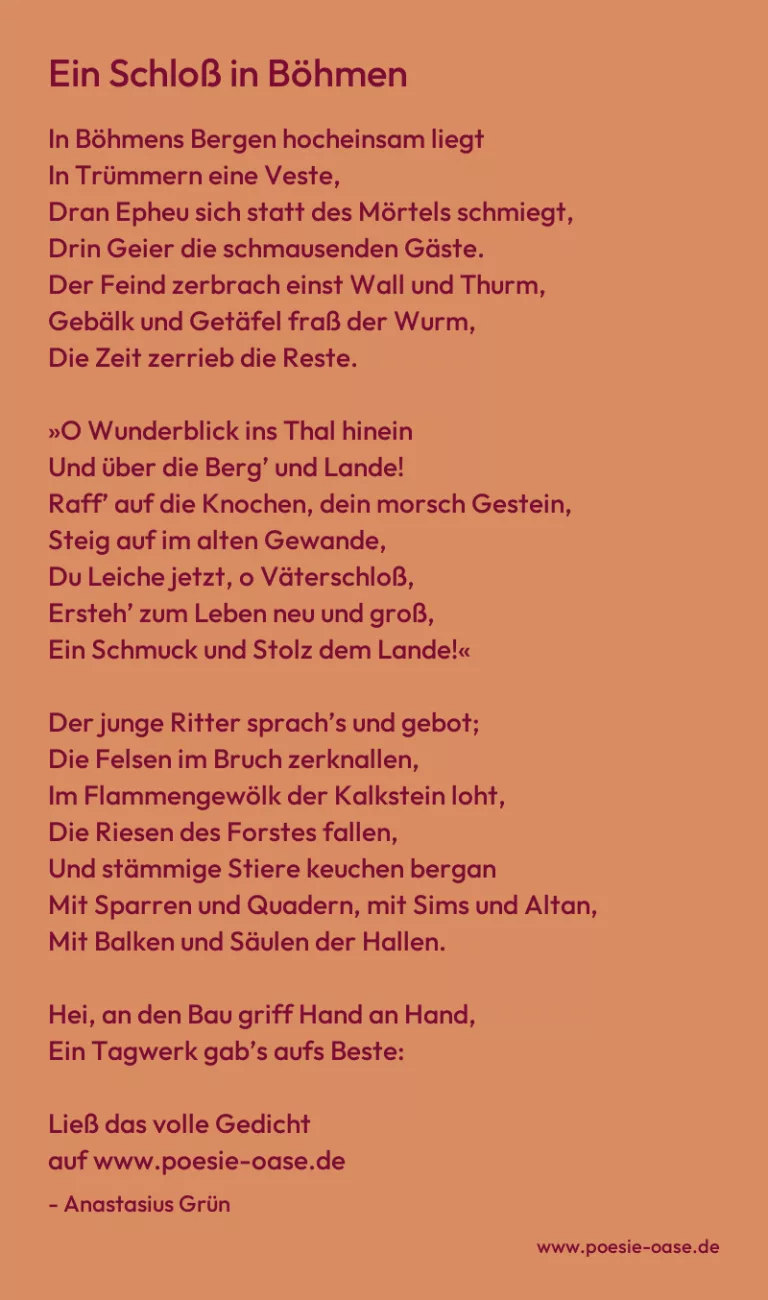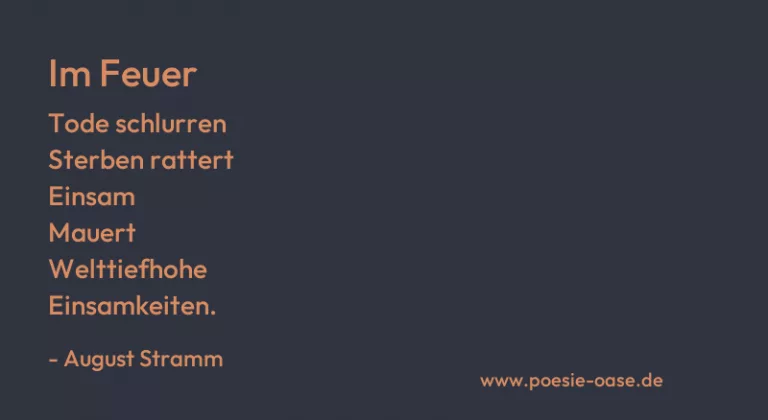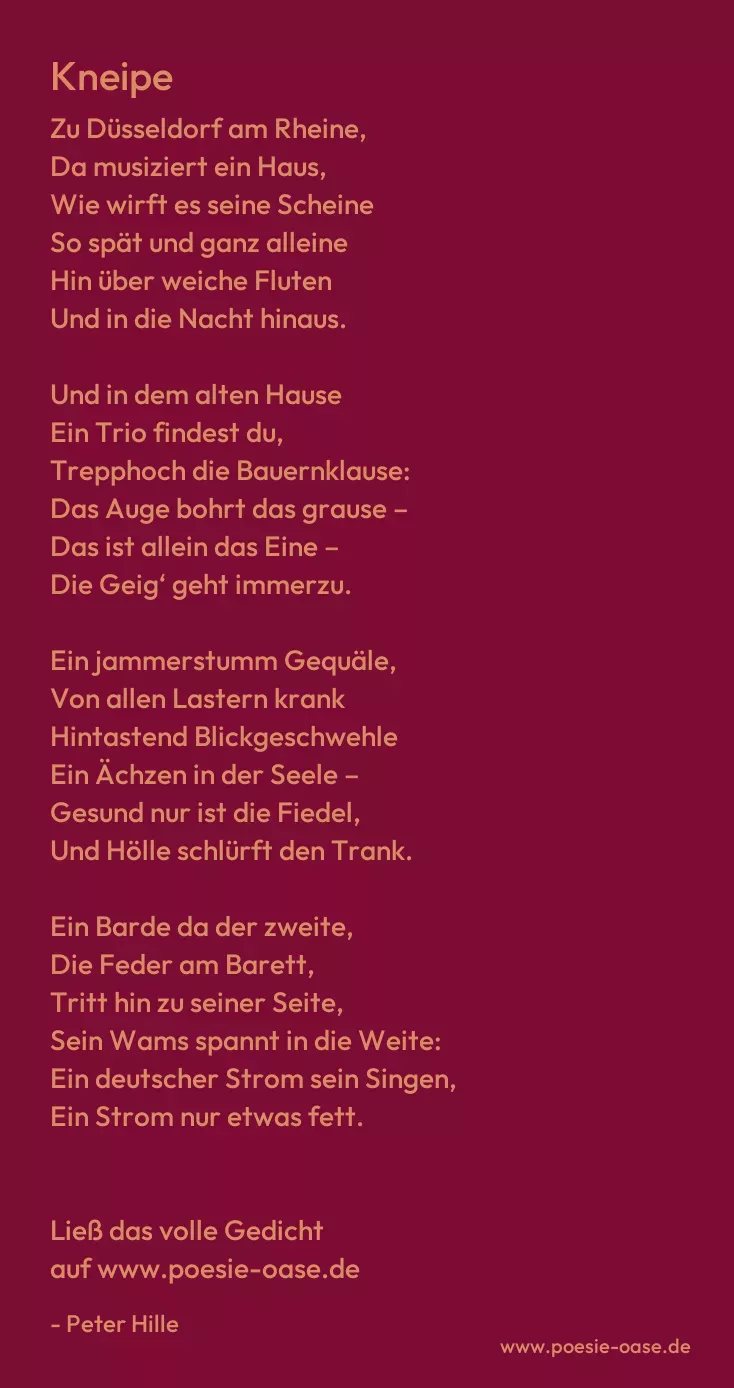Zu Düsseldorf am Rheine,
Da musiziert ein Haus,
Wie wirft es seine Scheine
So spät und ganz alleine
Hin über weiche Fluten
Und in die Nacht hinaus.
Und in dem alten Hause
Ein Trio findest du,
Trepphoch die Bauernklause:
Das Auge bohrt das grause –
Das ist allein das Eine –
Die Geig‘ geht immerzu.
Ein jammerstumm Gequäle,
Von allen Lastern krank
Hintastend Blickgeschwehle
Ein Ächzen in der Seele –
Gesund nur ist die Fiedel,
Und Hölle schlürft den Trank.
Ein Barde da der zweite,
Die Feder am Barett,
Tritt hin zu seiner Seite,
Sein Wams spannt in die Weite:
Ein deutscher Strom sein Singen,
Ein Strom nur etwas fett.
Sonst recht ein Minnesänger
Aus bunter Ritterzeit,
So recht ein Herzbedränger,
Ein Güldendankempfänger
In blauen Lockenprächten –
So frank, so frei, so weit.
Des Sinnes frohe Freite
Das blaue Auge warm,
Und ist ein Hochgeschreite,
Viel kühne Nackenbreite,
Die Glieder Mannesblüte,
Leicht, gut und ohne Harm.
Und neben Mährens Sohne
Am kleinen Tisch zu dritt,
Der trägt die Bürgerkrone,
Von Leichtsinn keine Bohne,
Der pustet Klarinette,
Trinkt dann gemessen mit.
Schwarz Buckel mit Manschetten
Setzt zu den Gästen sich,
Goldköpfig hochadretten,
In Themis Wagenwetten,
Als Advokat verschlagen,
Hochausbesitzerlich.
Agrarierzähren flossen
Als wie ein goldner Bach,
Noch eilig hingegossen,
Um zweie wird geschlossen,
Die Kellner gehn und räumen
Man fährt aus jähen Träumen –
Jach empor.