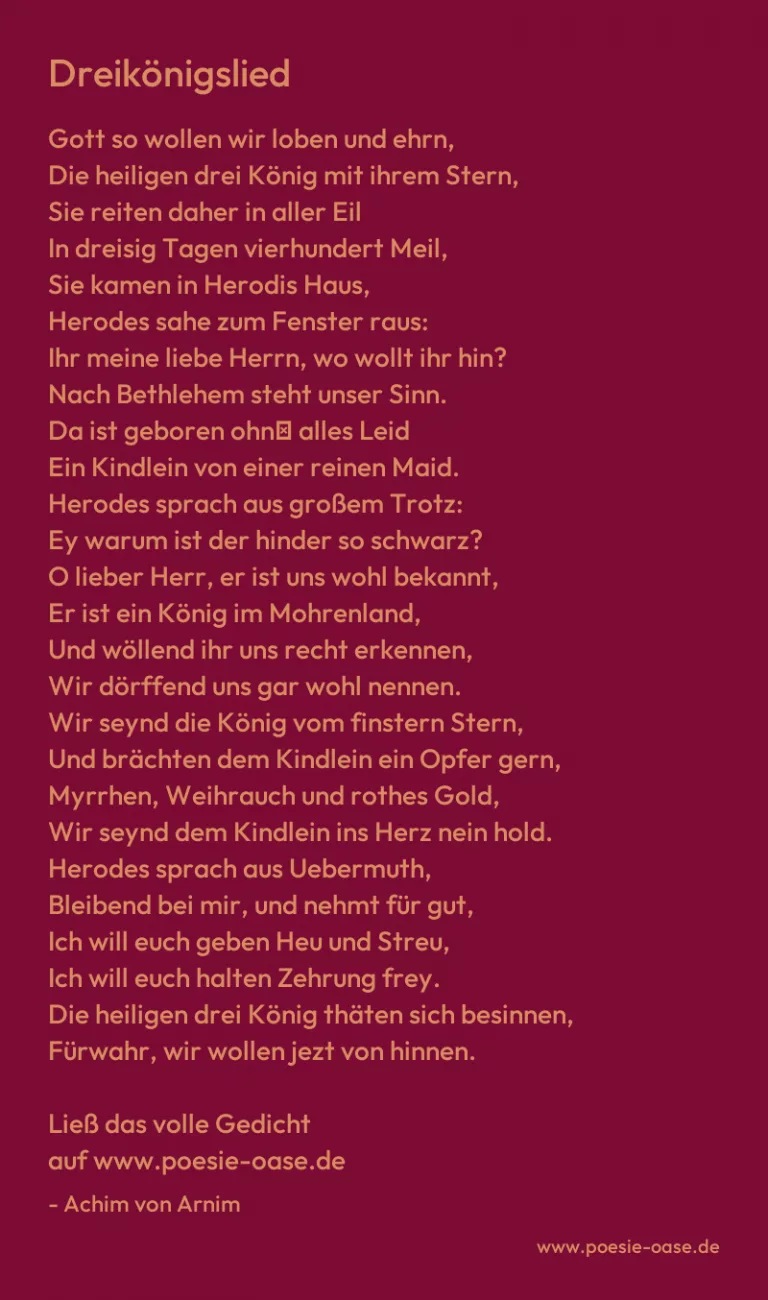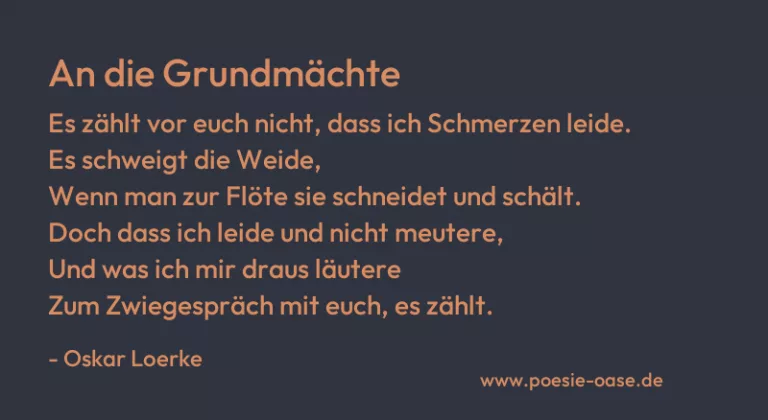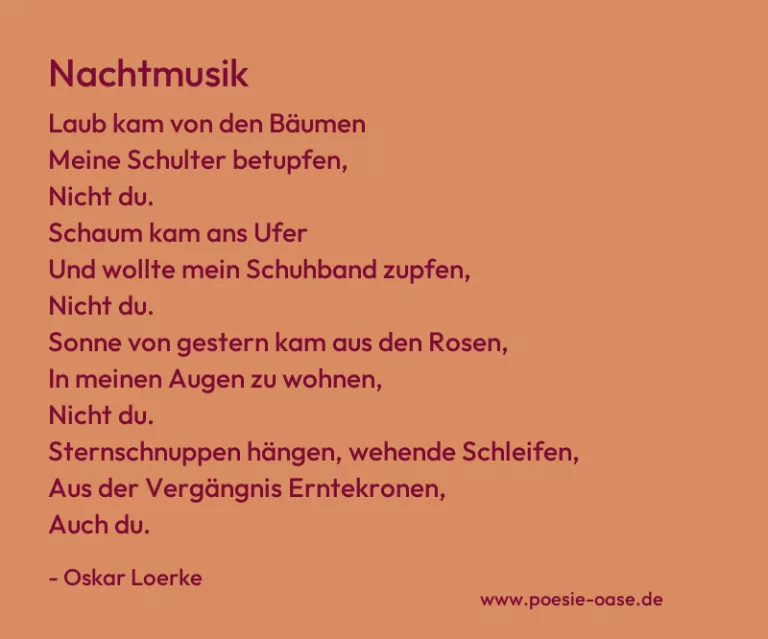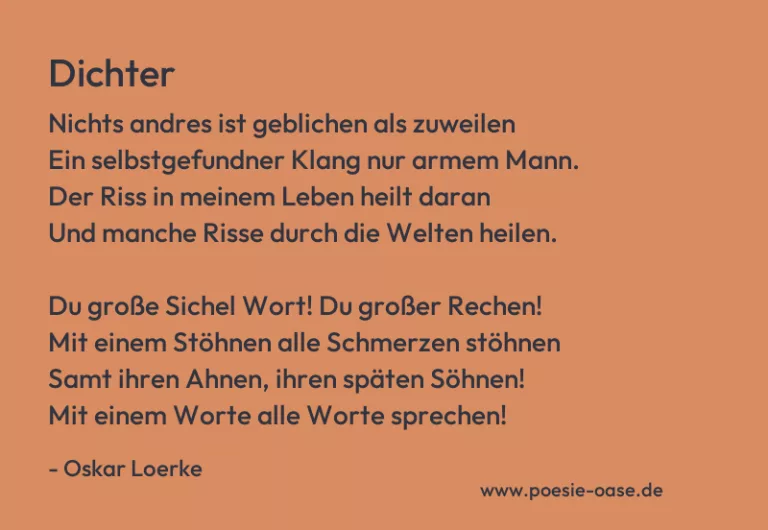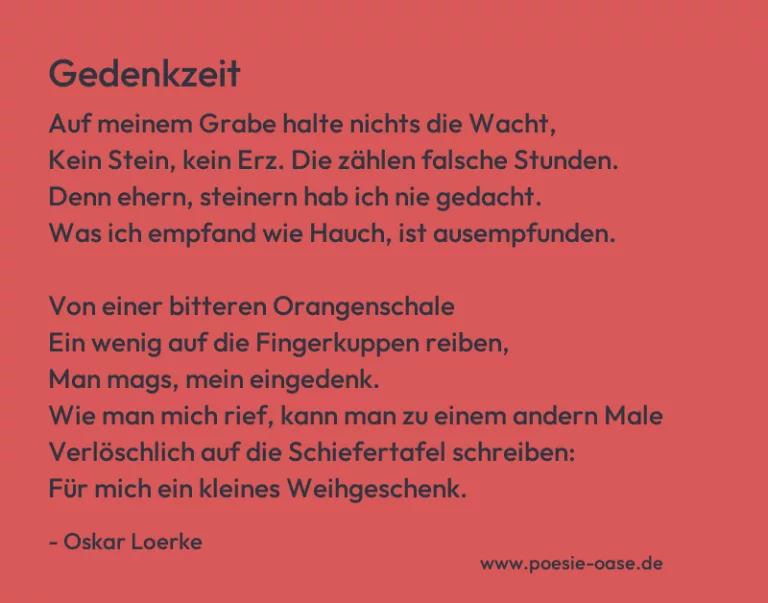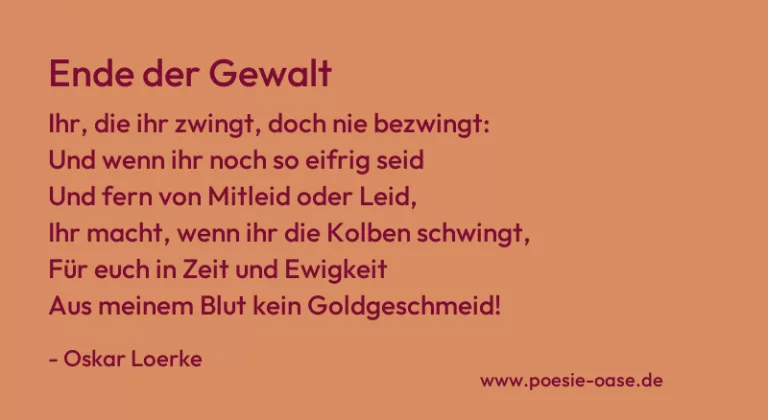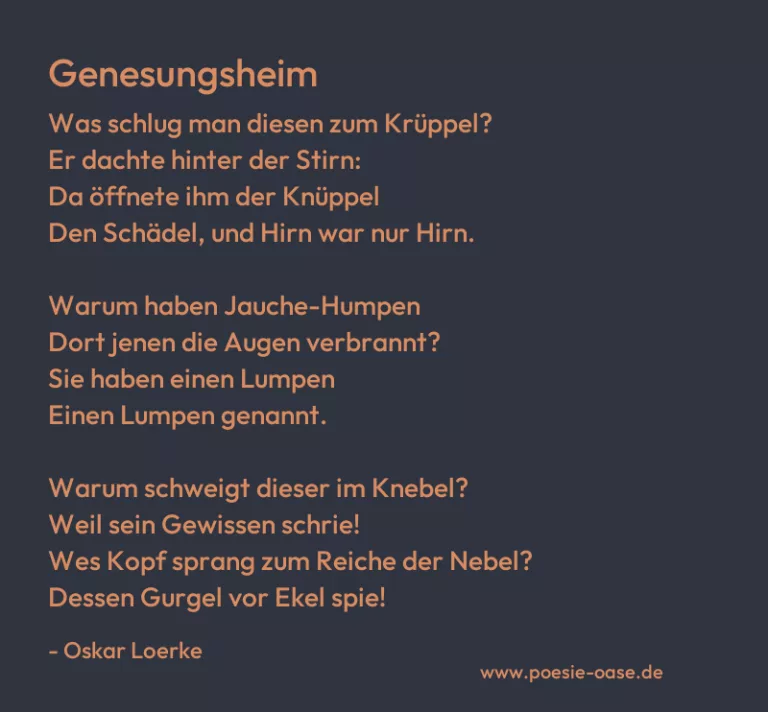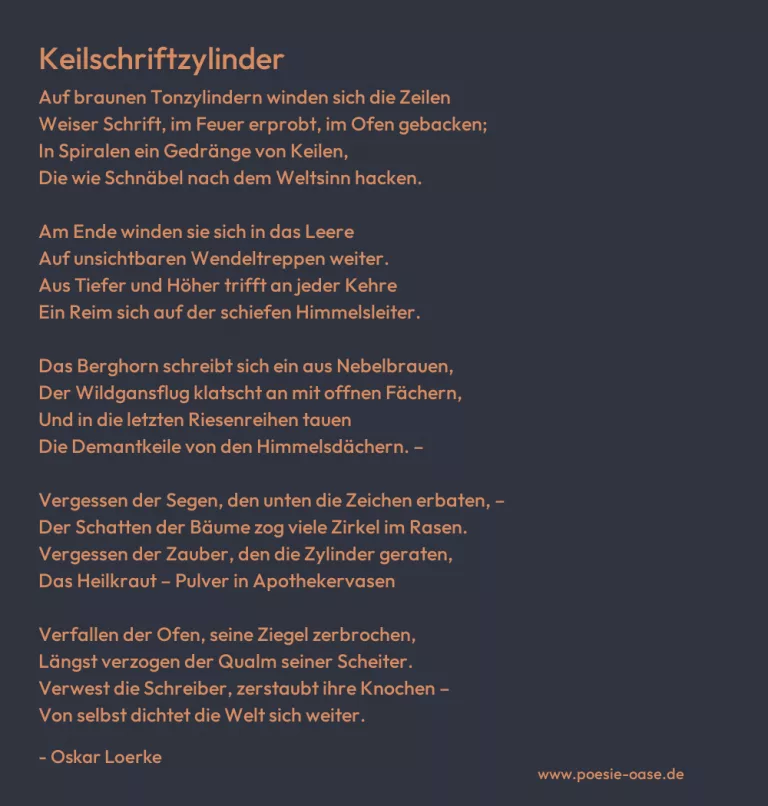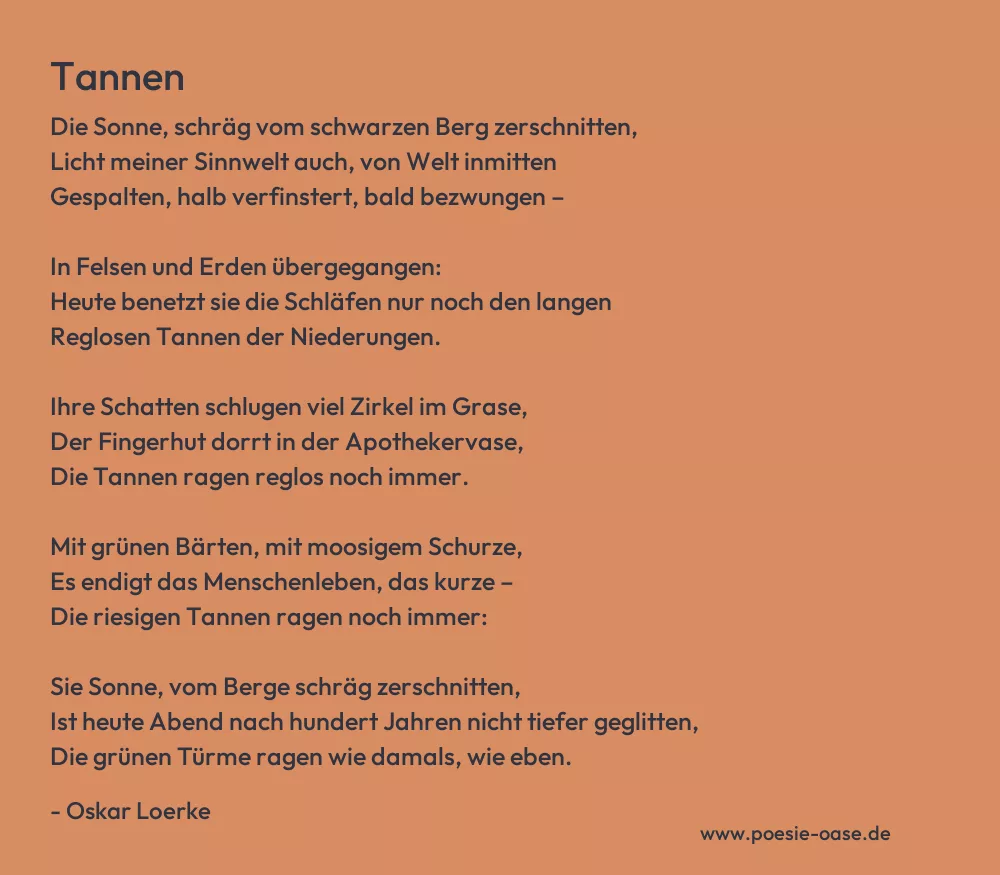Tannen
Die Sonne, schräg vom schwarzen Berg zerschnitten,
Licht meiner Sinnwelt auch, von Welt inmitten
Gespalten, halb verfinstert, bald bezwungen –
In Felsen und Erden übergegangen:
Heute benetzt sie die Schläfen nur noch den langen
Reglosen Tannen der Niederungen.
Ihre Schatten schlugen viel Zirkel im Grase,
Der Fingerhut dorrt in der Apothekervase,
Die Tannen ragen reglos noch immer.
Mit grünen Bärten, mit moosigem Schurze,
Es endigt das Menschenleben, das kurze –
Die riesigen Tannen ragen noch immer:
Sie Sonne, vom Berge schräg zerschnitten,
Ist heute Abend nach hundert Jahren nicht tiefer geglitten,
Die grünen Türme ragen wie damals, wie eben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
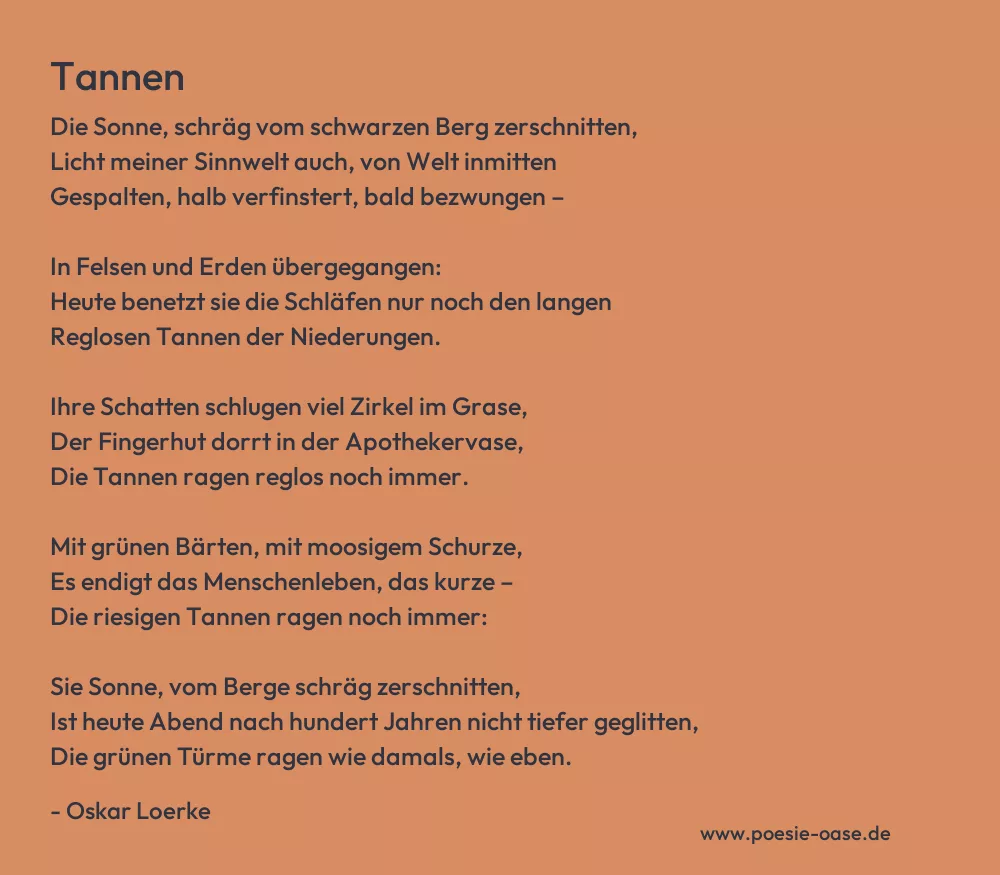
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Tannen“ von Oskar Loerke beschäftigt sich mit den Themen der Zeit, der Vergänglichkeit und der Natur als bleibendem, unveränderlichen Element im Vergleich zum menschlichen Leben. Zu Beginn beschreibt der Erzähler die Sonne, die „schräg vom schwarzen Berg zerschnitten“ wird. Diese bildhafte Darstellung vermittelt eine Welt, die geteilt und schwer fassbar ist – ein Spiegelbild des inneren Konflikts oder der Zerrissenheit. Die Sonne wird als Symbol für die Sinnwelt des Erzählers dargestellt, die in diesem Moment der Dämmerung oder des Übergangs „halb verfinstert, bald bezwungen“ erscheint. Der Übergang von Licht zu Dunkelheit wird als eine Metapher für die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und des Verstehens der Welt verwendet.
Im zweiten Teil des Gedichts wird die Natur als das bleibende Element beschrieben. Die „Tannen der Niederungen“ sind starr und reglos, sie ragen „noch immer“ und tragen das Bild der Unveränderlichkeit. Die Sonne, die in „Felsen und Erden übergegangen“ ist, ist nur noch ein entferntes, schwaches Licht, das „die Schläfen nur noch“ berührt. Diese Szenen beschreiben einen Zustand des Stillstands und der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Die Tannen erscheinen als Metapher für Beständigkeit, während der Mensch in seiner „Kurze“ und Zerbrechlichkeit im Vergleich zu diesen jahrhundertealten Bäumen unbedeutend erscheint.
Die „Schatten“, die „viel Zirkel im Grase“ schlagen, und das Bild des „Fingerhuts“, der in der „Apothekervase“ verdorrt, verstärken das Gefühl der Vergänglichkeit und des Verfalls. Der Fingerhut, ein pflanzliches Symbol, das in der Volksmedizin für Heilung steht, ist hier verwelkt und unbrauchbar geworden. Die Tannen jedoch, „mit grünen Bärten, mit moosigem Schurze“, ragen „noch immer“, was eine starke Kontrastierung zwischen der Sterblichkeit des Menschen und der scheinbaren Ewigkeit der Natur hervorruft. Die Tannen, die sich über den Raum und die Zeit hinweg erheben, symbolisieren das Fortbestehen von etwas größerem und langlebigerem als das menschliche Leben.
Am Ende des Gedichts bleibt das Bild der Tannen als Symbol für Kontinuität und Stabilität erhalten. „Die grünen Türme“ ragen noch immer, „wie damals, wie eben“, was die Idee verstärkt, dass die Natur und ihre Elemente unabhängig vom menschlichen Leben weiterbestehen. Die Sonne, die „nach hundert Jahren nicht tiefer geglitten“ ist, zeigt, dass der Lauf der Zeit in der Natur kontinuierlich verläuft, während das menschliche Leben – kurz und vergänglich – von diesen größeren natürlichen Kräften überschattet wird. Loerke nutzt hier die Tannen als metaphorisches Symbol für das, was bleibt, während der Mensch in seiner Endlichkeit von der Natur überdauert wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.