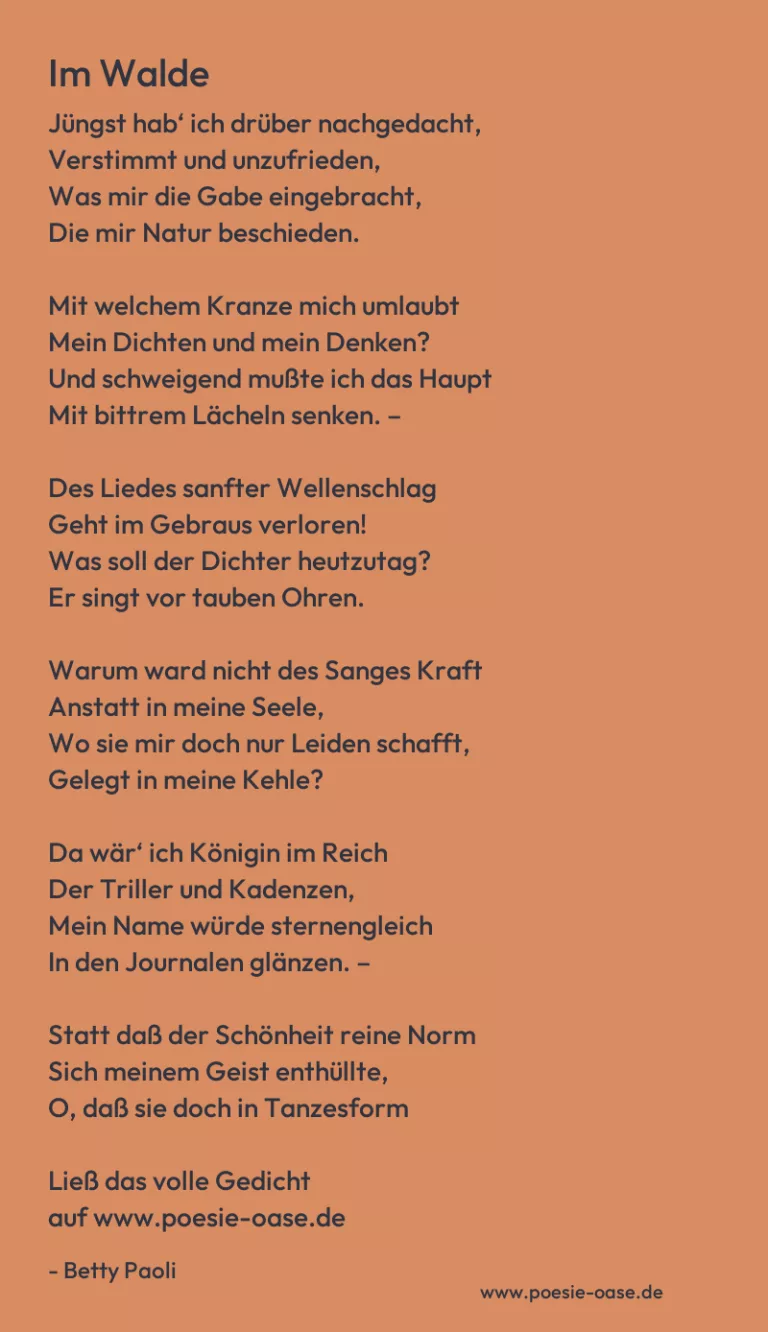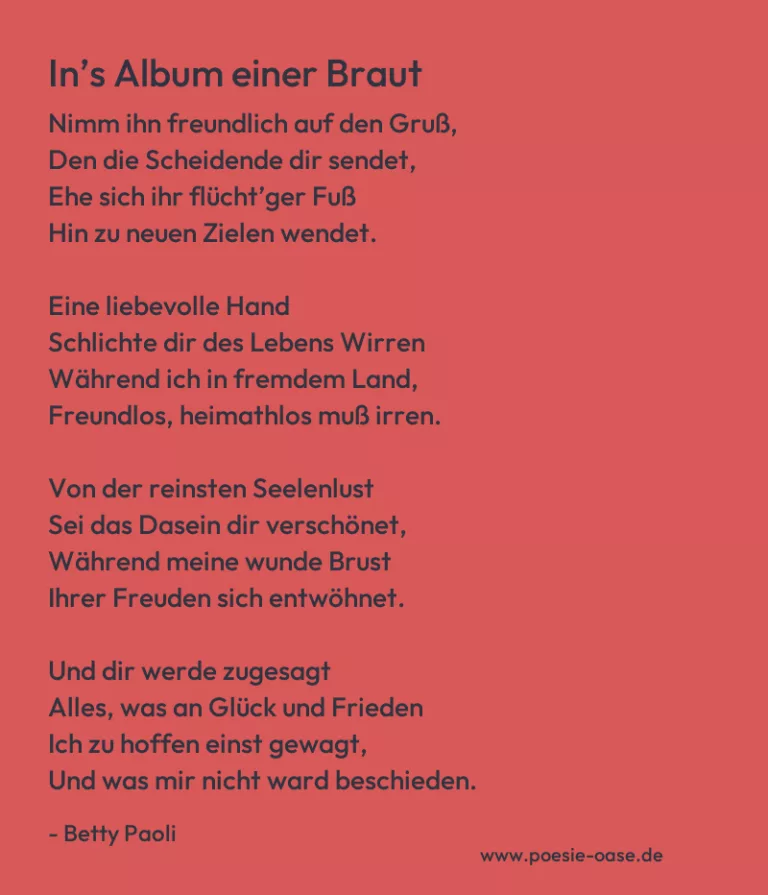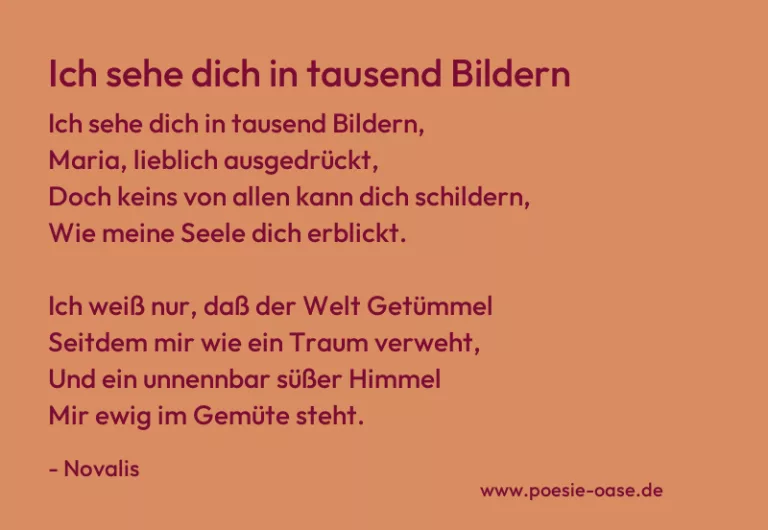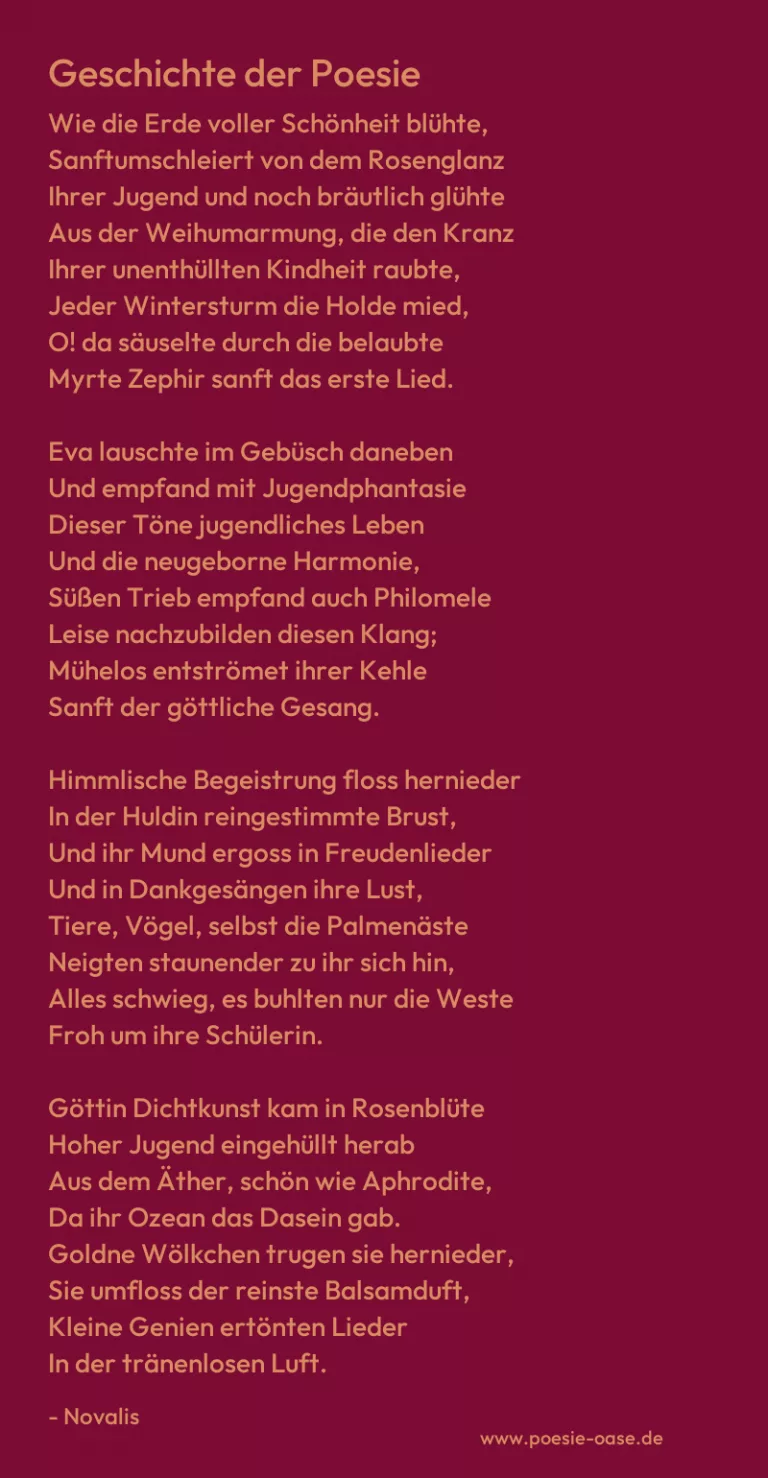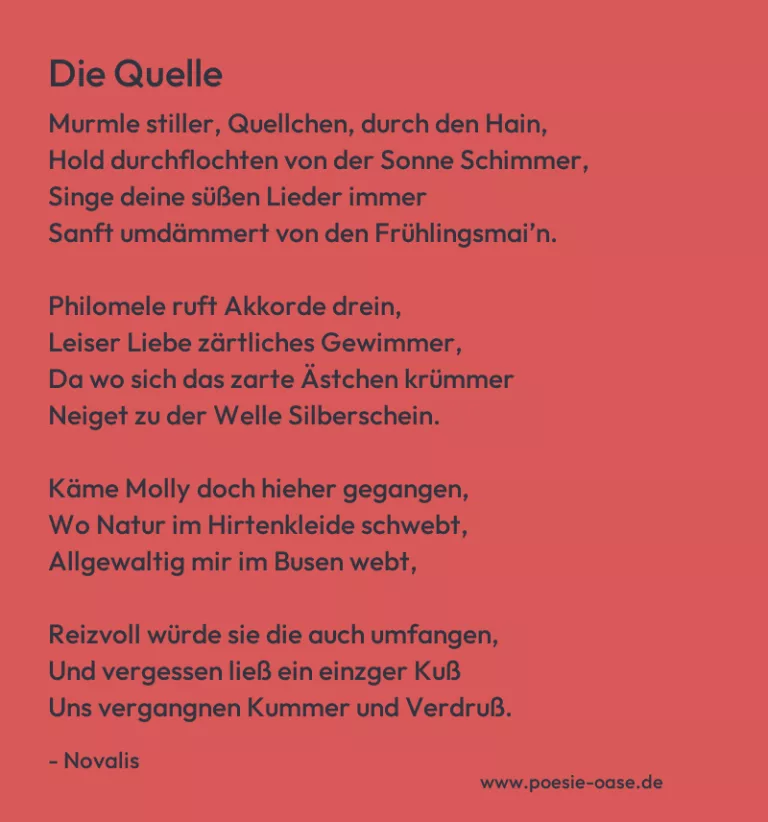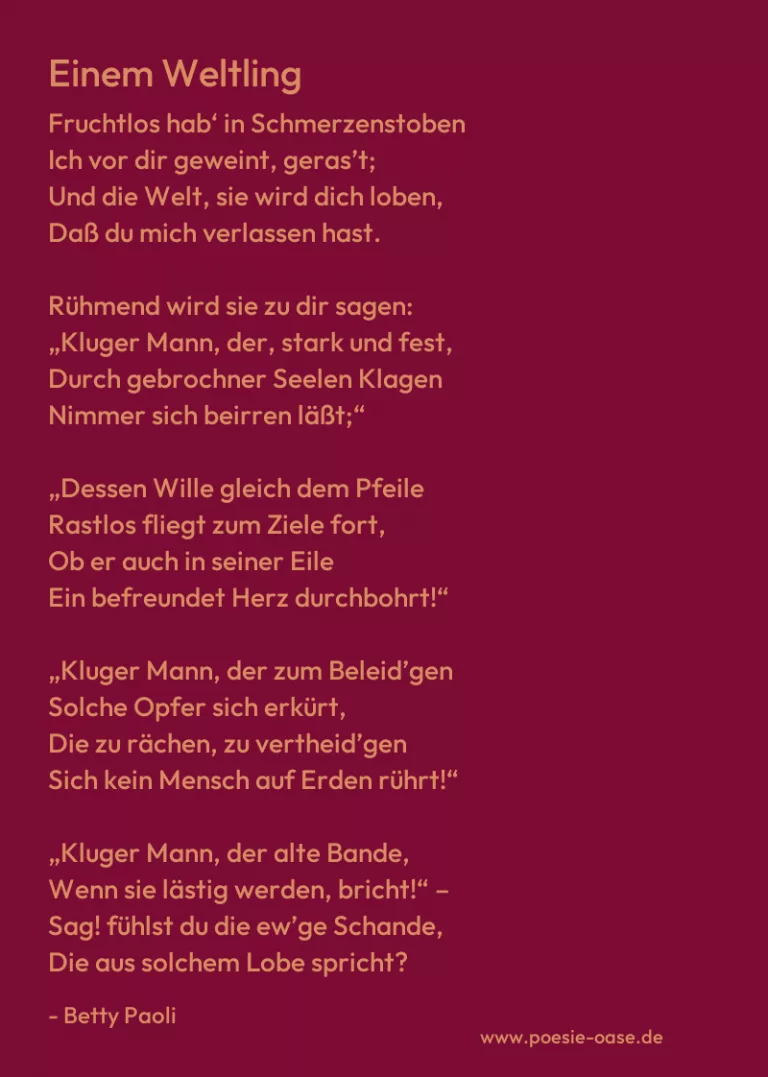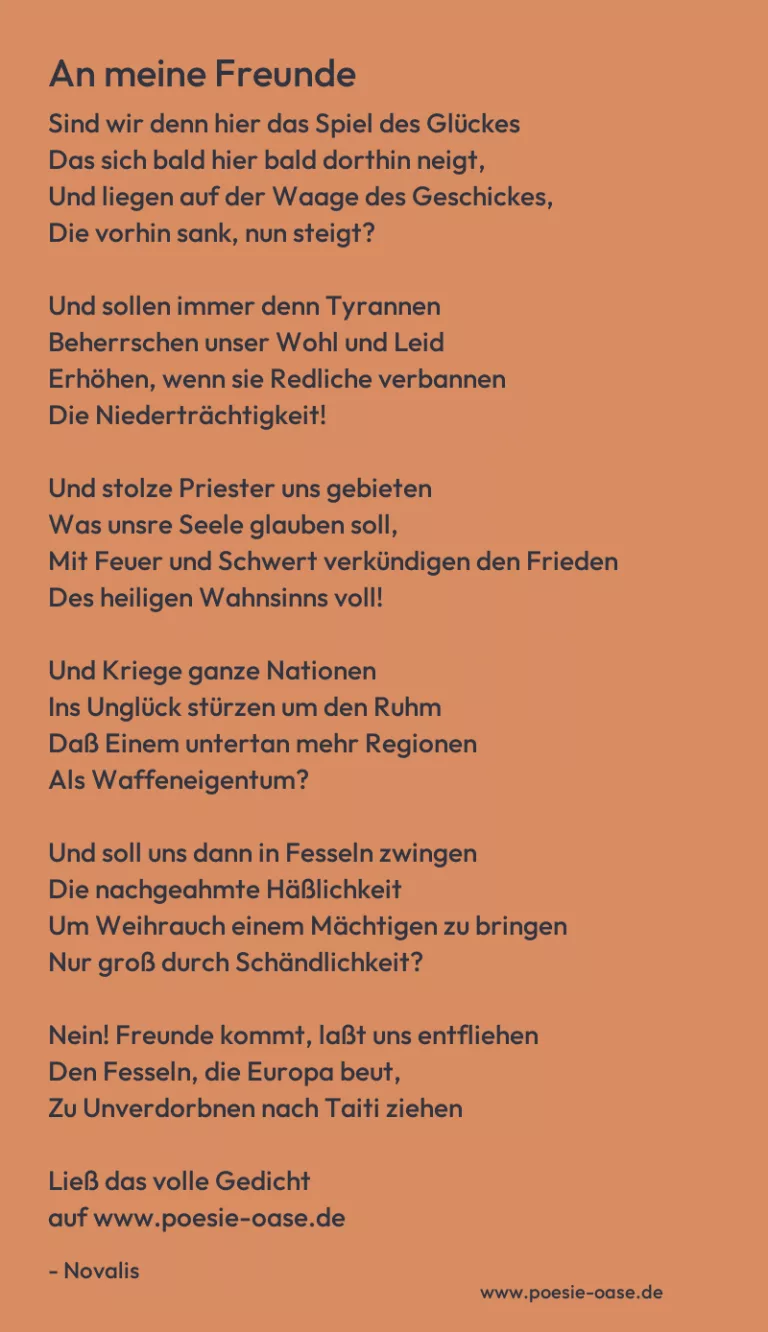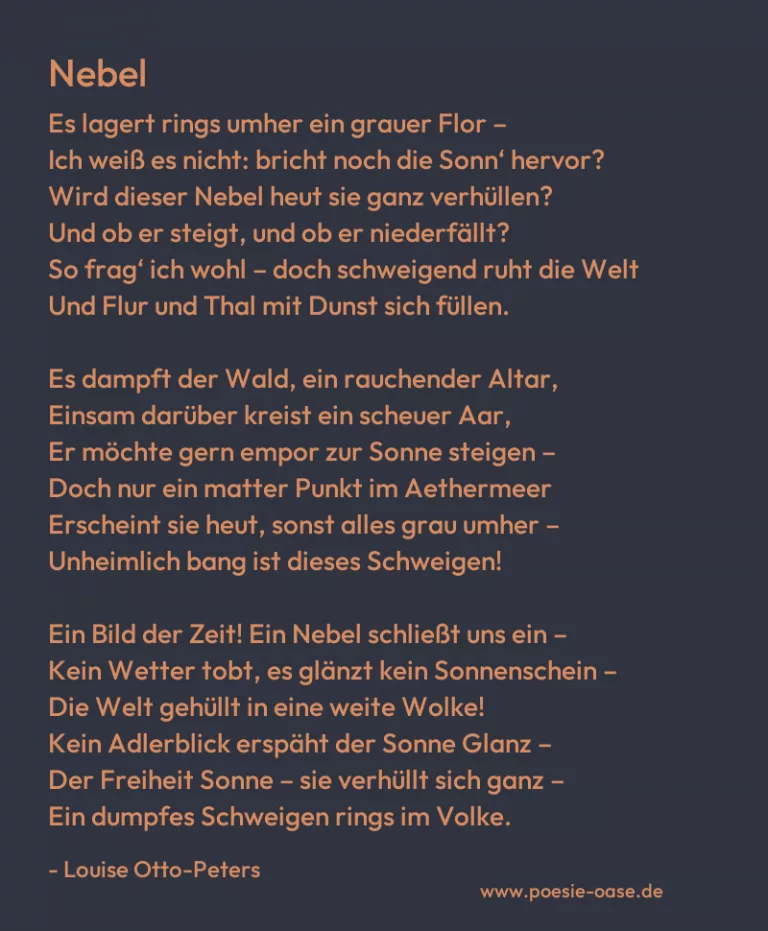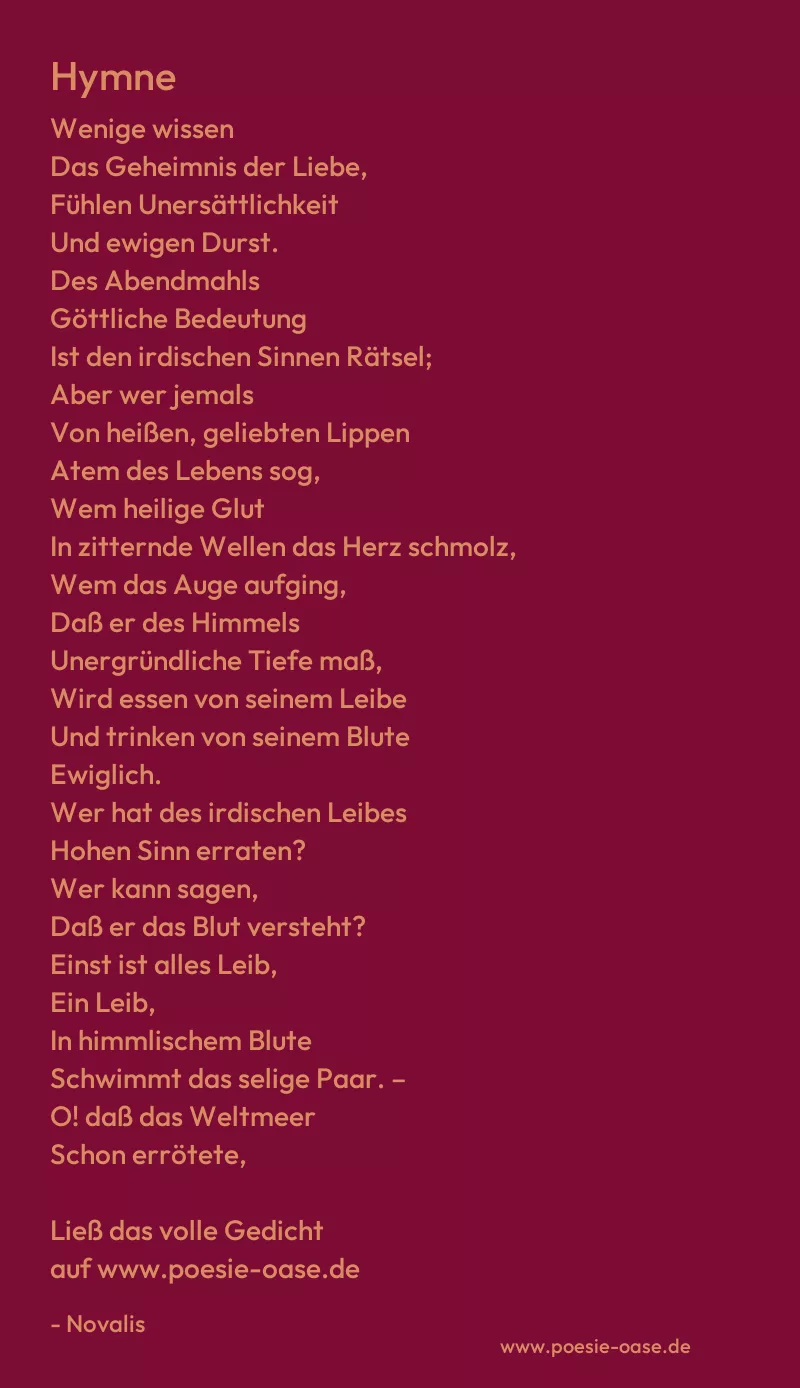Berge & Täler, Emotionen & Gefühle, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Harmonie, Helden & Prinzessinnen, Legenden, Mythen & Legenden, Spiritualität, Universum, Wissenschaft & Technik, Wut
Hymne
Wenige wissen
Das Geheimnis der Liebe,
Fühlen Unersättlichkeit
Und ewigen Durst.
Des Abendmahls
Göttliche Bedeutung
Ist den irdischen Sinnen Rätsel;
Aber wer jemals
Von heißen, geliebten Lippen
Atem des Lebens sog,
Wem heilige Glut
In zitternde Wellen das Herz schmolz,
Wem das Auge aufging,
Daß er des Himmels
Unergründliche Tiefe maß,
Wird essen von seinem Leibe
Und trinken von seinem Blute
Ewiglich.
Wer hat des irdischen Leibes
Hohen Sinn erraten?
Wer kann sagen,
Daß er das Blut versteht?
Einst ist alles Leib,
Ein Leib,
In himmlischem Blute
Schwimmt das selige Paar. –
O! daß das Weltmeer
Schon errötete,
Und in duftiges Fleisch
Aufquölle der Fels!
Nie endet das süße Mahl,
Nie sättigt die Liebe sich.
Nicht innig, nicht eigen genug
Kann sie haben den Geliebten.
Von immer zärteren Lippen
Verwandelt wird das Genossene
Inniglicher und näher.
Heißere Wollust
Durchbebt die Seele.
Durstiger und hungriger
Wird das Herz:
Und so währet der Liebe Genuß
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Hätten die Nüchternen
Einmal gekostet,
Alles verließen sie,
Und setzten sich zu uns
An den Tisch der Sehnsucht,
Der nie leer wird.
Sie erkennten der Liebe
Unendliche Fülle,
Und priesen die Nahrung
Von Leib und Blut.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
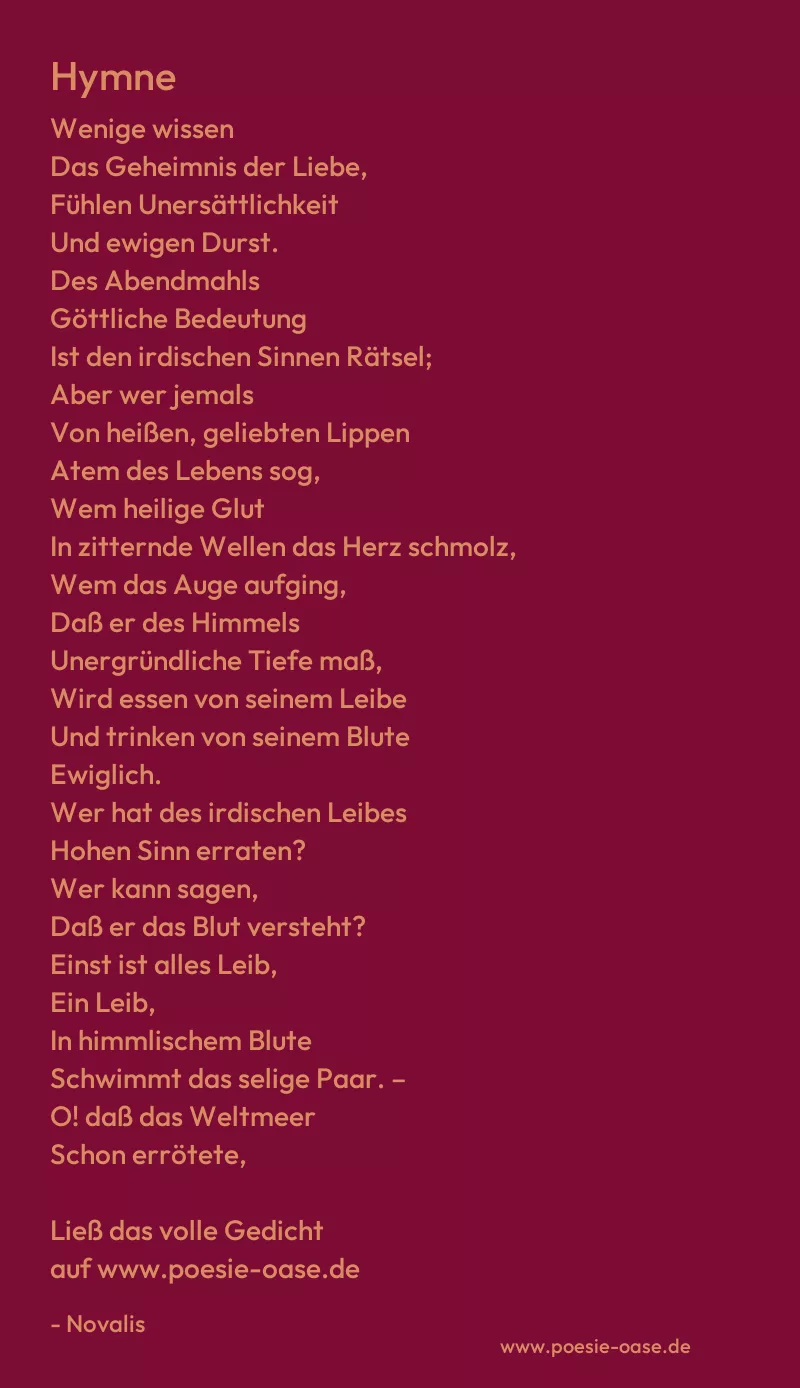
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hymne“ von Novalis ist ein mystisch durchdrungener Lobgesang auf die Liebe, die in ihrer tiefsten Form als heiliges, ja sakrales Erlebnis dargestellt wird. Dabei verschmilzt die sinnliche Liebe mit religiösen Bildern, insbesondere mit der Symbolik des christlichen Abendmahls. Novalis verbindet körperliche Vereinigung und geistige Ekstase zu einer ganzheitlichen Erfahrung, die über das Irdische hinausreicht und ins Ewige führt.
Zentrale Motive des Gedichts sind „Leib“ und „Blut“ – Begriffe, die sowohl körperlich-sinnlich als auch religiös aufgeladen sind. Der „Durst“ und die „Unersättlichkeit“ verweisen auf ein Verlangen, das nie vollkommen gestillt werden kann, weil die Liebe in ihrer Essenz unendlich ist. In diesem Verlangen liegt aber keine Qual, sondern eine ewige, sich steigernde Seligkeit. Das Bild des „Tisches der Sehnsucht“ evoziert das Abendmahl, wird jedoch zugleich zu einem Bild für die gemeinschaftliche Erfahrung einer Liebe, die nicht begrenzt, sondern durch ihre Unstillbarkeit vertieft wird.
Novalis spielt mit der Idee der Transzendenz durch körperliche Erfahrung. Wer die Liebe in ihrer Tiefe erfahren hat – symbolisiert durch den „Atem des Lebens“ und das „zärtliche Mahl“ – wird über die gewöhnliche, irdische Wahrnehmung hinausgehoben. Die Liebenden schwimmen „in himmlischem Blute“, was die völlige Durchdringung von Geist und Körper, von Diesseits und Jenseits ausdrückt. Der Fels, der zu Fleisch wird, das Weltmeer, das errötet – solche Bilder betonen die Metamorphose der Welt durch die Kraft der Liebe.
Auch das Verhältnis von Individualität und Verschmelzung spielt eine zentrale Rolle: Die Liebe strebt danach, den Geliebten „inniglicher und näher“ zu haben, ihn ganz in sich aufzunehmen. Dabei verliert sich das Ich nicht, sondern erfährt sich in einer neuen, tieferen Dimension. Der Zustand des Liebens wird zu einer ewigen Bewegung, ein fortwährender Prozess der Annäherung und Verwandlung.
„Hymne“ ist somit nicht nur ein Gedicht über zwischenmenschliche Liebe, sondern ein romantisches Bekenntnis zur heiligen Einheit von Körper und Geist, von Sinnlichkeit und Spiritualität. Novalis entfaltet eine visionäre Mystik, in der Liebe zum höchsten Erkenntnisweg wird – ein Weg, der zur göttlichen Wahrheit führt und alles Irdische übersteigt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.