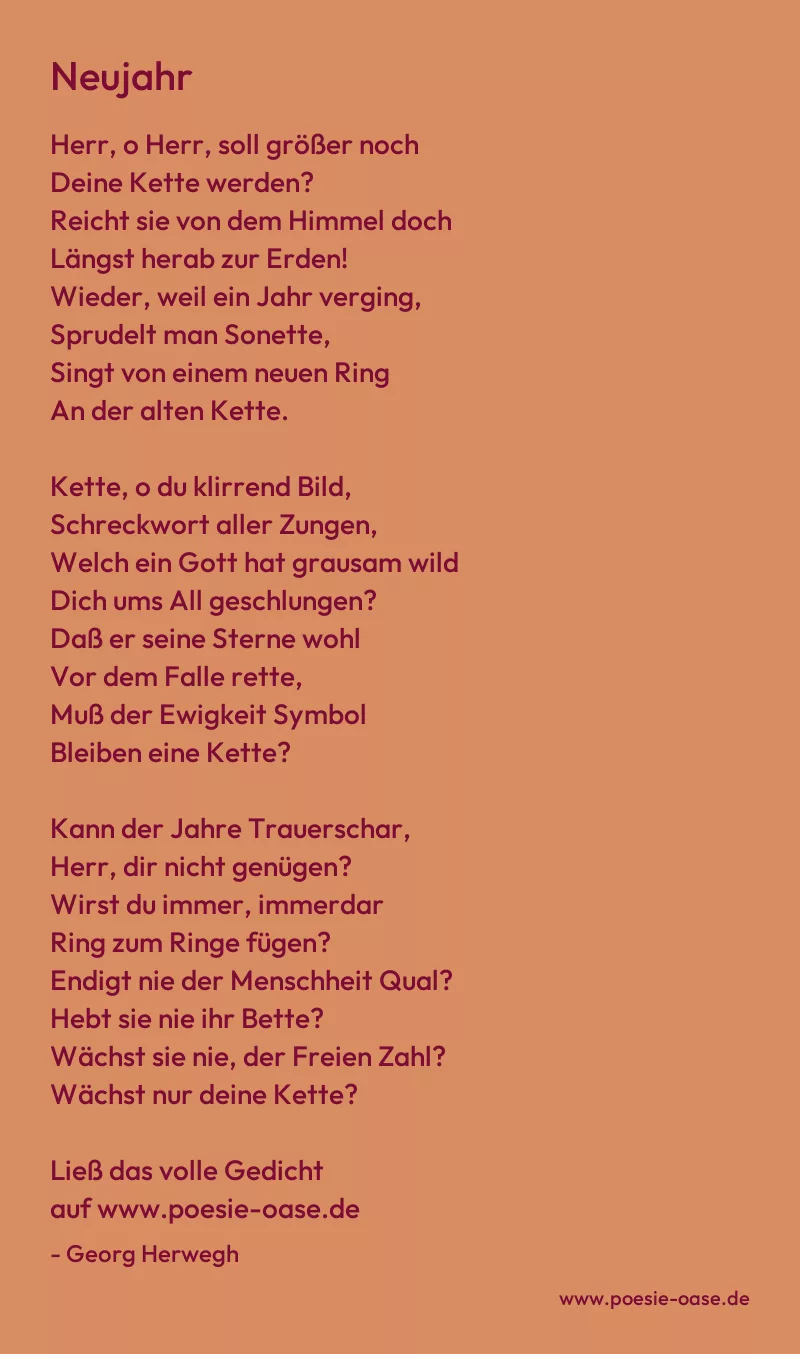Herr, o Herr, soll größer noch
Deine Kette werden?
Reicht sie von dem Himmel doch
Längst herab zur Erden!
Wieder, weil ein Jahr verging,
Sprudelt man Sonette,
Singt von einem neuen Ring
An der alten Kette.
Kette, o du klirrend Bild,
Schreckwort aller Zungen,
Welch ein Gott hat grausam wild
Dich ums All geschlungen?
Daß er seine Sterne wohl
Vor dem Falle rette,
Muß der Ewigkeit Symbol
Bleiben eine Kette?
Kann der Jahre Trauerschar,
Herr, dir nicht genügen?
Wirst du immer, immerdar
Ring zum Ringe fügen?
Endigt nie der Menschheit Qual?
Hebt sie nie ihr Bette?
Wächst sie nie, der Freien Zahl?
Wächst nur deine Kette?
Fragend schaut′ ich manche Nacht
Auf zu deinen Hallen;
Endlich, hab′ ich oft gedacht,
Muß die Kette fallen.
Ach! mein Hoffen trieb im Sturm
Auf dem letzten Brette,
Und ward, ein getretner Wurm,
Auch ein Ring der Kette.
Herr, o spare deinen Grimm
Fürder den Tyrannen,
Einmal mit dem Jahre nimm
Einen Ring von dannen!
Gib uns, was wir heiß gesucht,
Trüg′s auch Dorn und Klette,
Mindre nur die schwere Wucht
Deiner goldnen Kette!
Nimm, die sie so lang umfing,
Nimm sie von der Erden;
Laß der Kette letzten Ring
Freiheitsbrautring werden!
Höre unser banges Schrein:
Herr, o Herr, errette,
Und den Teufel laß allein
Ewig an der Kette!
Ja! du wirst. Schon seh′ ich, traun!
Neue Sterne ziehen,
Neue Tempel seh′ ich baun,
Neue Völker knieen;
Donnerklang und Harfenton
Rufen in die Mette –
Still! die Engel opfern schon
Einen Ring der Kette.