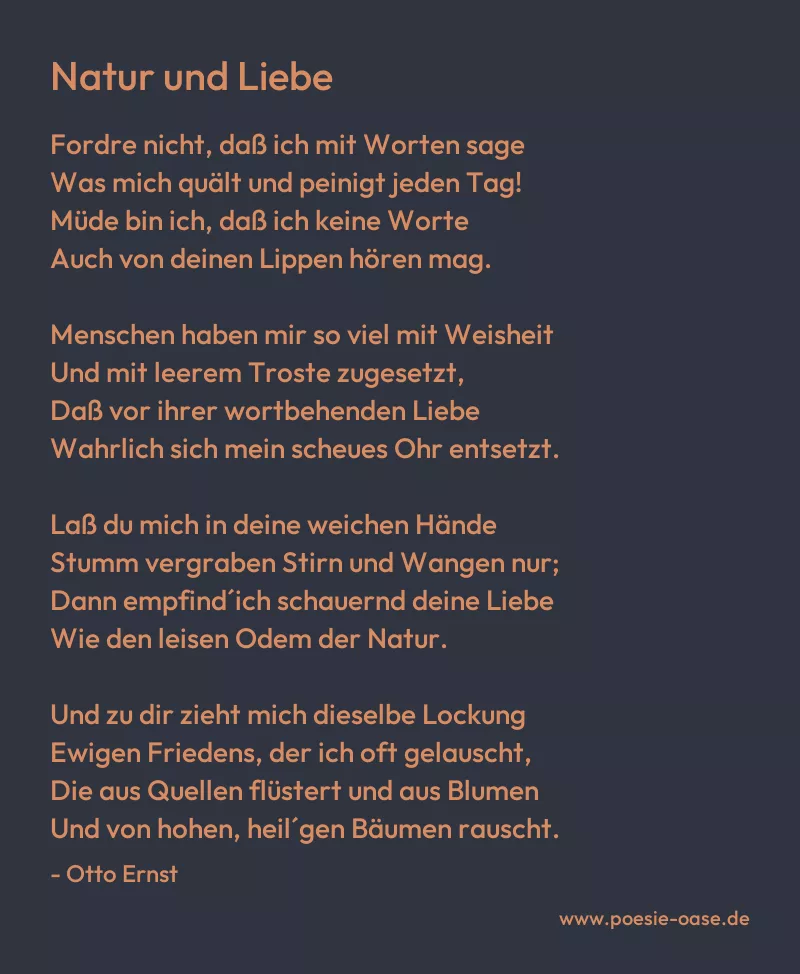Natur und Liebe
Fordre nicht, daß ich mit Worten sage
Was mich quält und peinigt jeden Tag!
Müde bin ich, daß ich keine Worte
Auch von deinen Lippen hören mag.
Menschen haben mir so viel mit Weisheit
Und mit leerem Troste zugesetzt,
Daß vor ihrer wortbehenden Liebe
Wahrlich sich mein scheues Ohr entsetzt.
Laß du mich in deine weichen Hände
Stumm vergraben Stirn und Wangen nur;
Dann empfind´ich schauernd deine Liebe
Wie den leisen Odem der Natur.
Und zu dir zieht mich dieselbe Lockung
Ewigen Friedens, der ich oft gelauscht,
Die aus Quellen flüstert und aus Blumen
Und von hohen, heil´gen Bäumen rauscht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
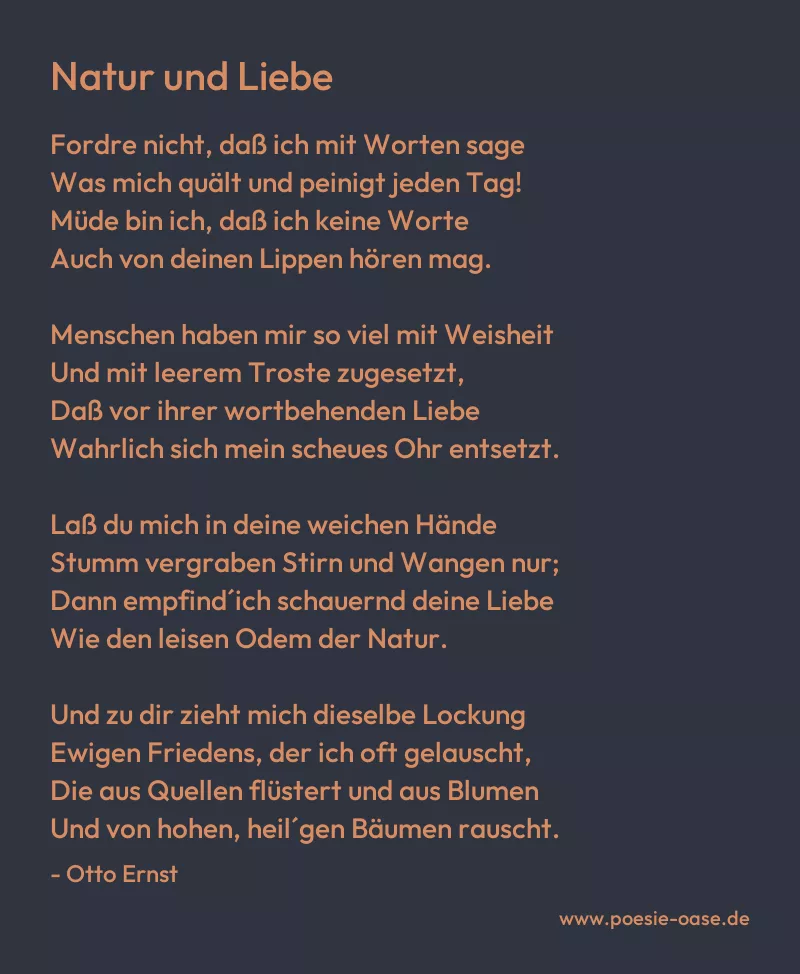
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Natur und Liebe“ von Otto Ernst ist eine melancholische Reflexion über die Erschöpfung durch die Welt der Worte und die Sehnsucht nach einer wortlosen, unmittelbaren Verbindung mit der Natur und der Liebe. Es ist ein Appell an eine stille, empfindsame Kommunikation, die dem Reden und den Weisheiten der Menschen vorgezogen wird. Der Sprecher des Gedichts ist müde von den leeren Worten und dem Trost, den ihm die Menschen bieten. Er sehnt sich nach einer Erfahrung, die jenseits der Sprache liegt und sich in der Stille der Natur und der liebevollen Geste widerspiegelt.
In den ersten beiden Strophen wird die Distanz zur menschlichen Welt deutlich. Der Sprecher beschreibt seine Erschöpfung durch die vielen Worte, die ihn quälen und peinigen. Die „wortbehende Liebe“ der Menschen löst in ihm Abscheu aus. Er wünscht sich eine Abkehr von der verbalen Kommunikation, die ihm anscheinend mehr Schaden als Trost gebracht hat. Stattdessen sucht er nach einer Verbindung, die frei von den Zwängen der Sprache ist und sich in der Nähe der Natur findet.
Die dritte Strophe markiert den Übergang zu einer intimeren Beziehung. Der Sprecher bittet um eine stille Geste der Liebe, die sich in den „weichen Händen“ manifestiert. Hier findet er Trost und Geborgenheit, die sich in dem Gefühl der Liebe widerspiegeln, ähnlich dem „leisen Odem der Natur“. Die Berührung und die Nähe werden zum Ausdruck von Liebe, der die Sprache überflüssig macht.
In der letzten Strophe wird die Verbindung zur Natur vertieft. Die „Lockung“ des ewigen Friedens, die der Sprecher oft in der Natur wahrgenommen hat, zieht ihn zu seinem Geliebten. Diese Lockung manifestiert sich im Flüstern der Quellen, den Blumen und dem Rauschen der Bäume. Die Natur wird zum Sinnbild für eine tiefe, stille und ewig währende Liebe. Das Gedicht feiert somit die Einheit von Natur und Liebe als Quelle des Friedens und der Erfüllung, fernab der lauten Welt der Worte.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.