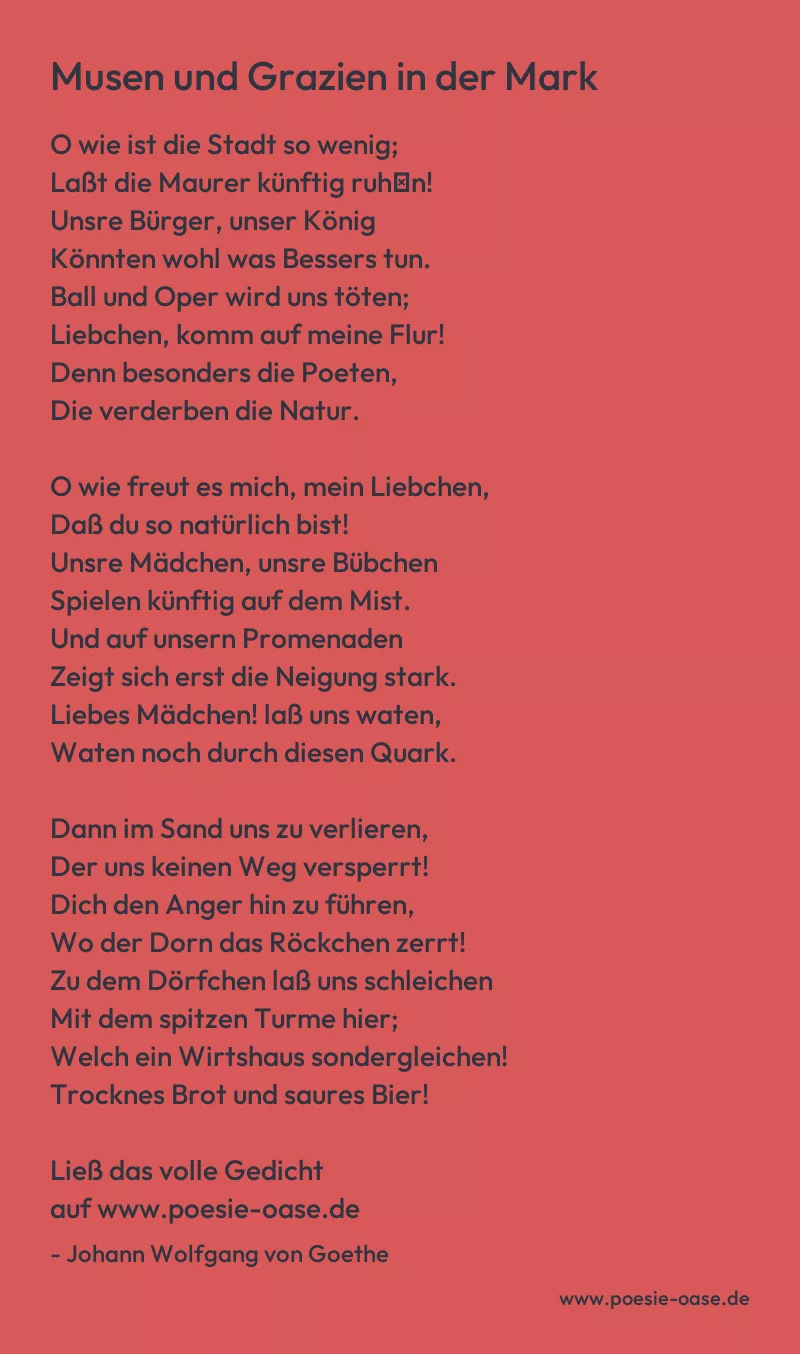O wie ist die Stadt so wenig;
Laßt die Maurer künftig ruh′n!
Unsre Bürger, unser König
Könnten wohl was Bessers tun.
Ball und Oper wird uns töten;
Liebchen, komm auf meine Flur!
Denn besonders die Poeten,
Die verderben die Natur.
O wie freut es mich, mein Liebchen,
Daß du so natürlich bist!
Unsre Mädchen, unsre Bübchen
Spielen künftig auf dem Mist.
Und auf unsern Promenaden
Zeigt sich erst die Neigung stark.
Liebes Mädchen! laß uns waten,
Waten noch durch diesen Quark.
Dann im Sand uns zu verlieren,
Der uns keinen Weg versperrt!
Dich den Anger hin zu führen,
Wo der Dorn das Röckchen zerrt!
Zu dem Dörfchen laß uns schleichen
Mit dem spitzen Turme hier;
Welch ein Wirtshaus sondergleichen!
Trocknes Brot und saures Bier!
Sagt mir nichts von gutem Boden,
Nichts vom Magdeburger Land!
Unsre Samen, unsre Toten,
Ruhen in dem leichten Sand.
Selbst die Wissenschaft verlieret
Nichts an ihren! raschen Lauf;
Denn bei uns, was vegetieret,
Alles keimt getrocknet auf.
Geht es nicht in unserm Hofe
Wie im Paradiese zu?
Statt der Dame, statt der Zofe
Macht die Henne glu! glu! glu!
Uns beschäftigt nicht der Pfauen,
Nur der Gänse Lebenslauf;
Meine Mutter zieht die grauen,
Meine Frau die weißen auf.
Laß den Witzling uns besticheln!
Glücklich, wenn ein deutscher Mann
Seinem Freunde Vetter Micheln
Guten Abend bieten kann.
Wie ist der Gedanke labend:
„Solch ein Edler bleibt uns nah!“
Immer sagt man: „Gestern abend
War doch Vetter Michel da!“
Und in unsern Liedern keimet
Silb aus Silbe, Wort aus Wort.
Ob sich gleich auf Deutsch nichts reimet,
Reimt der Deutsche dennoch fort.
Ob es kräftig oder zierlich,
Geht uns so genau nicht an;
Wir sind bieder und natürlich,
Und das ist genug getan.