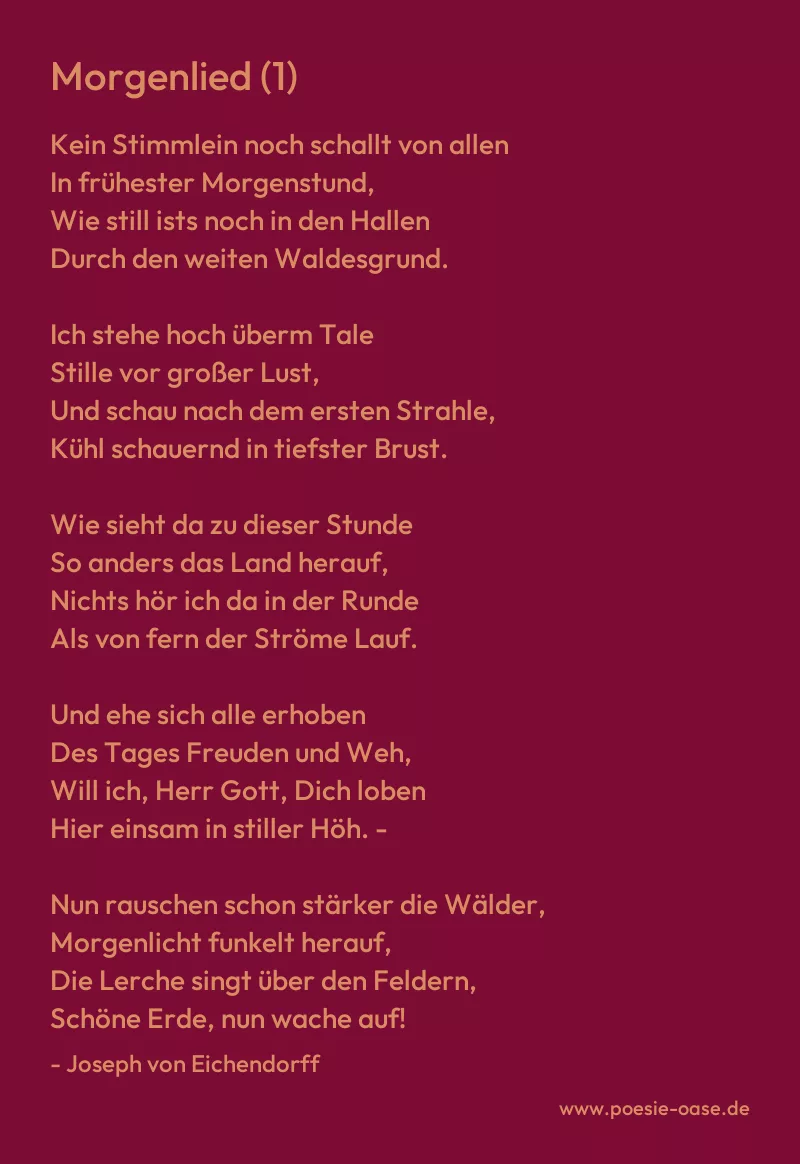Morgenlied (1)
Kein Stimmlein noch schallt von allen
In frühester Morgenstund,
Wie still ists noch in den Hallen
Durch den weiten Waldesgrund.
Ich stehe hoch überm Tale
Stille vor großer Lust,
Und schau nach dem ersten Strahle,
Kühl schauernd in tiefster Brust.
Wie sieht da zu dieser Stunde
So anders das Land herauf,
Nichts hör ich da in der Runde
Als von fern der Ströme Lauf.
Und ehe sich alle erhoben
Des Tages Freuden und Weh,
Will ich, Herr Gott, Dich loben
Hier einsam in stiller Höh. –
Nun rauschen schon stärker die Wälder,
Morgenlicht funkelt herauf,
Die Lerche singt über den Feldern,
Schöne Erde, nun wache auf!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
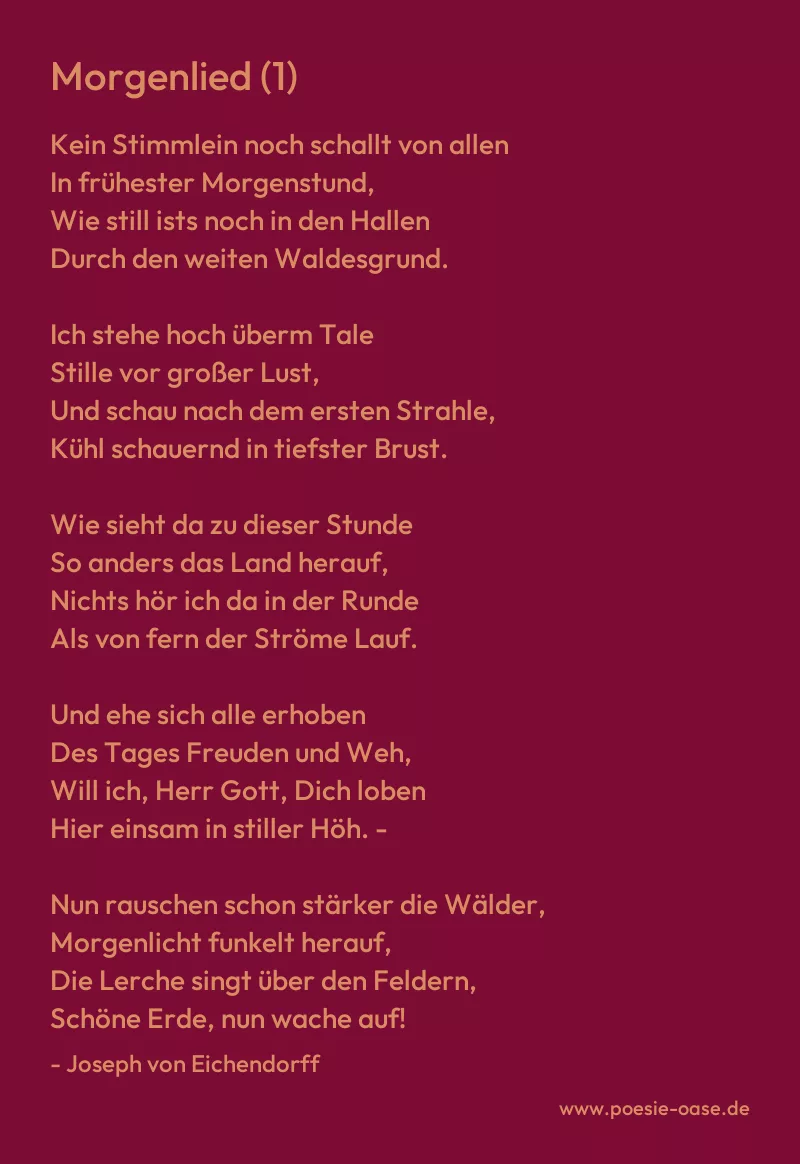
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Morgenlied (1)“ von Joseph von Eichendorff ist eine besinnliche Naturbetrachtung, die die Stille und den Zauber des Morgens einfängt und in eine Anrufung Gottes mündet. Der Dichter beschreibt in einfachen, melodischen Versen die Erlebnisse und Empfindungen eines lyrischen Ichs, das den Sonnenaufgang in der Natur erlebt. Die ersten drei Strophen zeichnen ein Bild der Stille und Einsamkeit, wobei die Natur als unberührt und friedlich dargestellt wird. Der Kontrast zwischen der absoluten Stille der frühen Morgenstunden und der allmählichen Erweckung der Natur durch das einfallende Licht bildet das zentrale Thema des Gedichts.
In den ersten drei Strophen wird die Stille durch bildhafte Beschreibungen verstärkt. Das Fehlen von Vogelgesang und anderen Geräuschen unterstreicht die friedliche Atmosphäre und die Kontemplation des lyrischen Ichs. Dieses steht „hoch überm Tale“, was eine erhöhte Perspektive suggeriert und das Gefühl der Erhabenheit und Distanz vom Alltag verstärkt. Die „kühle schauernd in tiefster Brust“ deutet auf eine tiefe emotionale Reaktion auf die Schönheit des Morgens hin, wobei sowohl das Gefühl der Ehrfurcht als auch der Freude zum Ausdruck kommen. Der Blick auf das erwachende Land, das sich „so anders“ zeigt, verstärkt den Eindruck des Besonderen und des Wunders, das in dieser frühen Stunde liegt.
Die vierte Strophe markiert einen Übergang vom rein beschreibenden Teil zur religiösen Besinnung. Das lyrische Ich nutzt die Stille und Erhabenheit der Natur, um Gott zu loben. Dieser Moment der Dankbarkeit und Anbetung wird als ein intimer, einsamer Akt auf einer „stillen Höh“ beschrieben. Hier verbindet Eichendorff die Natur mit der Spiritualität, indem er die Schönheit des Morgens als Anlass für die Gottesverehrung nutzt. Die Natur dient als Katalysator für die religiöse Erfahrung, wodurch die Verbindung zwischen Mensch, Natur und Gott hergestellt wird.
Die letzte Strophe, die den Übergang zum aktiven Tag darstellt, beschreibt die allmähliche Erweckung der Natur. Das Rauschen der Wälder und das Funkeln des Morgenlichts zeigen, dass der Tag nun beginnt. Der Gesang der Lerche über den Feldern steht für die Freude und das Erwachen des Lebens. Der letzte Vers, „Schöne Erde, nun wache auf!“, ist eine Aufforderung und gleichzeitig eine Feier des Neubeginns. Es ist ein Aufruf an die Natur, sich in ihrer vollen Pracht zu entfalten, und spiegelt die Begeisterung und das Staunen des Dichters wider, die durch die Erfahrung des Morgens geweckt wurden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.