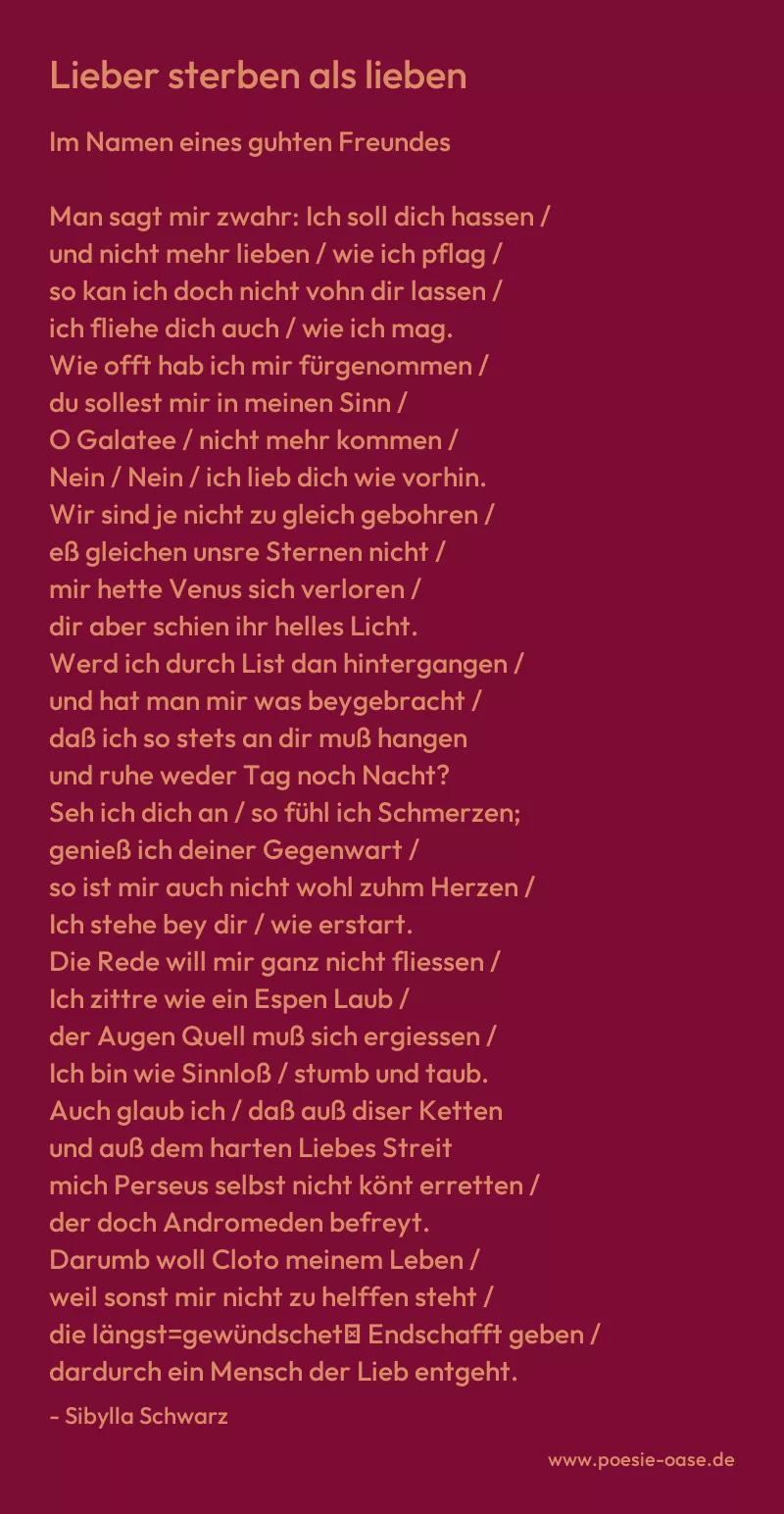Lieber sterben als lieben
Im Namen eines guhten Freundes
Man sagt mir zwahr: Ich soll dich hassen /
und nicht mehr lieben / wie ich pflag /
so kan ich doch nicht vohn dir lassen /
ich fliehe dich auch / wie ich mag.
Wie offt hab ich mir fürgenommen /
du sollest mir in meinen Sinn /
O Galatee / nicht mehr kommen /
Nein / Nein / ich lieb dich wie vorhin.
Wir sind je nicht zu gleich gebohren /
eß gleichen unsre Sternen nicht /
mir hette Venus sich verloren /
dir aber schien ihr helles Licht.
Werd ich durch List dan hintergangen /
und hat man mir was beygebracht /
daß ich so stets an dir muß hangen
und ruhe weder Tag noch Nacht?
Seh ich dich an / so fühl ich Schmerzen;
genieß ich deiner Gegenwart /
so ist mir auch nicht wohl zuhm Herzen /
Ich stehe bey dir / wie erstart.
Die Rede will mir ganz nicht fliessen /
Ich zittre wie ein Espen Laub /
der Augen Quell muß sich ergiessen /
Ich bin wie Sinnloß / stumb und taub.
Auch glaub ich / daß auß diser Ketten
und auß dem harten Liebes Streit
mich Perseus selbst nicht könt erretten /
der doch Andromeden befreyt.
Darumb woll Cloto meinem Leben /
weil sonst mir nicht zu helffen steht /
die längst=gewündschet′ Endschafft geben /
dardurch ein Mensch der Lieb entgeht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
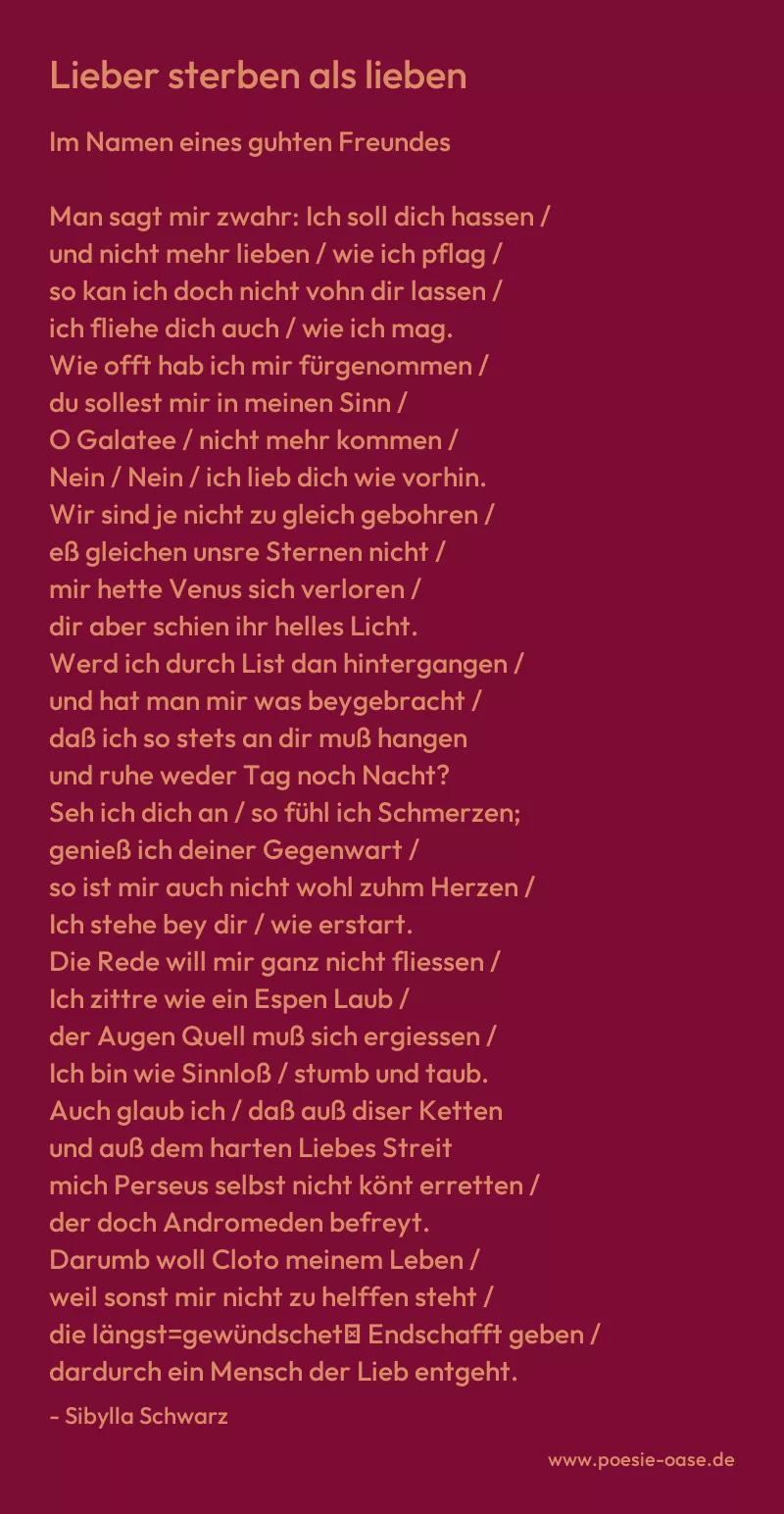
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Lieber sterben als lieben“ von Sibylla Schwarz ist eine klagende, melancholische Reflexion über die Qualen der unerwiderten Liebe. Es ist ein Ausdruck der Verzweiflung und der Sehnsucht nach Erlösung von den Leiden, die die Liebe verursacht. Das Gedicht beginnt mit dem Widerstreit zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen, die die Dichterin zum Hass auf die geliebte Person drängen, und dem unbezwingbaren Gefühl der Liebe, das sie trotz aller Bemühungen nicht loslassen kann. Sie flieht, doch die Liebe ist stärker, ein Gefangener seiner eigenen Emotionen.
Der zweite Teil des Gedichts verdeutlicht die Ungleichheit der Liebenden. Die unterschiedlichen „Sterne“ und die Anspielung auf Venus, der Göttin der Liebe, deuten auf die unterschiedliche Natur der Charaktere hin. Während der Geliebte in Venus‘ hellem Licht strahlt, ist die Dichterin der Liebe und ihren Konsequenzen unterworfen. Die anschließenden Strophen beschreiben die körperlichen und emotionalen Symptome der unerwiderten Liebe: Schmerzen, Unwohlsein, Sprachlosigkeit, Zittern und Tränen. Dies verdeutlicht die Intensität des Leids und die Macht der unerfüllten Sehnsucht.
Die Anspielung auf Perseus, der Andromedas befreite, unterstreicht die Hoffnungslosigkeit der Dichterin. Selbst ein Held, der in der Mythologie für seine Rettungstaten bekannt ist, könnte sie nicht aus der „Kette“ der Liebe befreien. Diese Unfähigkeit, sich von der Liebe zu lösen, führt zu dem verzweifelten Wunsch nach dem Tod als einzigem Ausweg. Die letzte Strophe enthält einen Appell an Clotho, eine der Moiren (Schicksalsgöttinnen), um ihr Leben zu beenden. Durch den Tod, so scheint es, kann der Mensch der Liebe und ihren Leiden entgehen.
Insgesamt ist das Gedicht ein eindringlicher Ausdruck der Verzweiflung über die unerwiderte Liebe. Die Autorin verwendet eine einfache, aber eindrucksvolle Sprache, um die emotionalen und körperlichen Auswirkungen der Liebe zu beschreiben. Die Verwendung von mythologischen Anspielungen verstärkt die Dramatik und die Hoffnungslosigkeit der Situation. Das Gedicht spiegelt die typischen Themen der Barocklyrik wider: die Vergänglichkeit des Lebens, die Qualen der Liebe und die Sehnsucht nach Erlösung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.