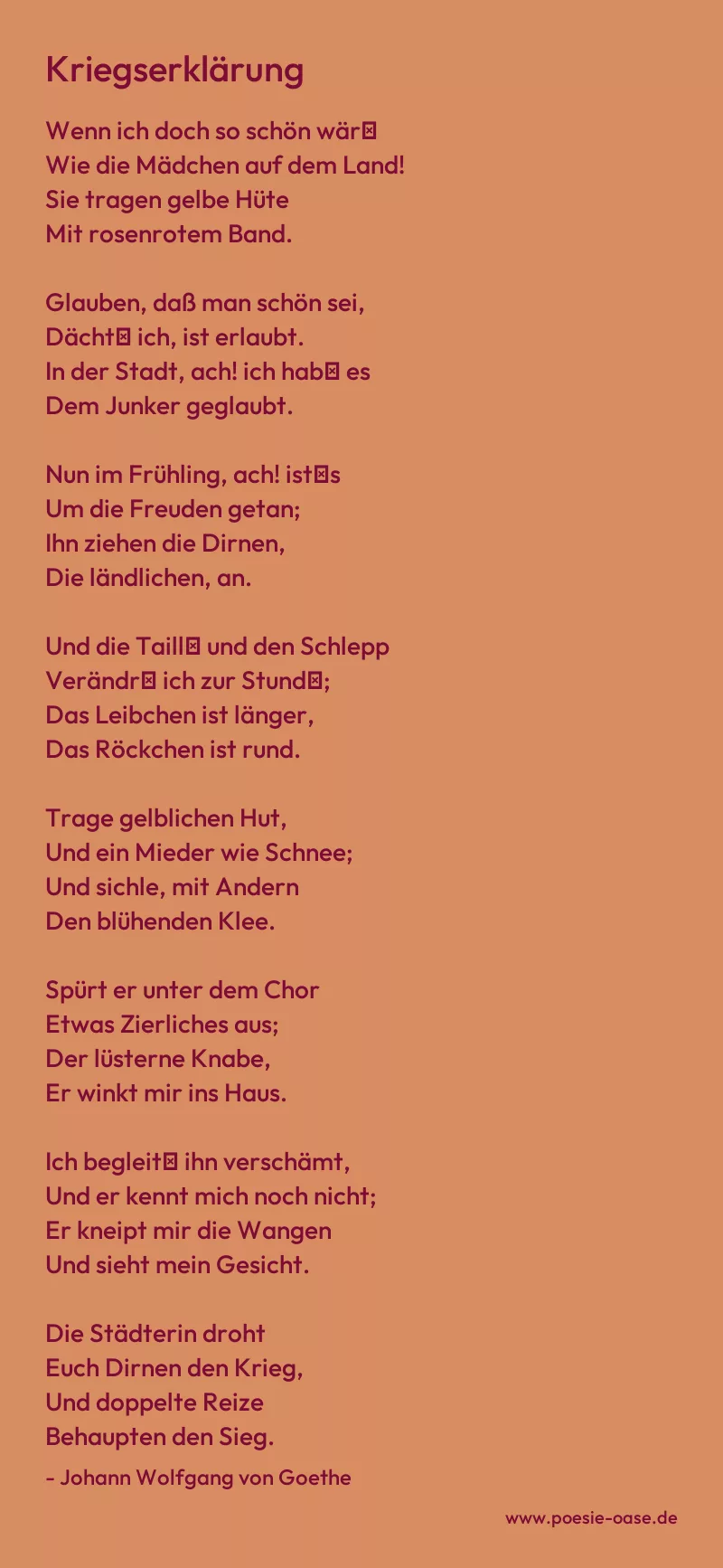Kriegserklärung
Wenn ich doch so schön wär′
Wie die Mädchen auf dem Land!
Sie tragen gelbe Hüte
Mit rosenrotem Band.
Glauben, daß man schön sei,
Dächt′ ich, ist erlaubt.
In der Stadt, ach! ich hab′ es
Dem Junker geglaubt.
Nun im Frühling, ach! ist′s
Um die Freuden getan;
Ihn ziehen die Dirnen,
Die ländlichen, an.
Und die Taill′ und den Schlepp
Verändr′ ich zur Stund′;
Das Leibchen ist länger,
Das Röckchen ist rund.
Trage gelblichen Hut,
Und ein Mieder wie Schnee;
Und sichle, mit Andern
Den blühenden Klee.
Spürt er unter dem Chor
Etwas Zierliches aus;
Der lüsterne Knabe,
Er winkt mir ins Haus.
Ich begleit′ ihn verschämt,
Und er kennt mich noch nicht;
Er kneipt mir die Wangen
Und sieht mein Gesicht.
Die Städterin droht
Euch Dirnen den Krieg,
Und doppelte Reize
Behaupten den Sieg.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
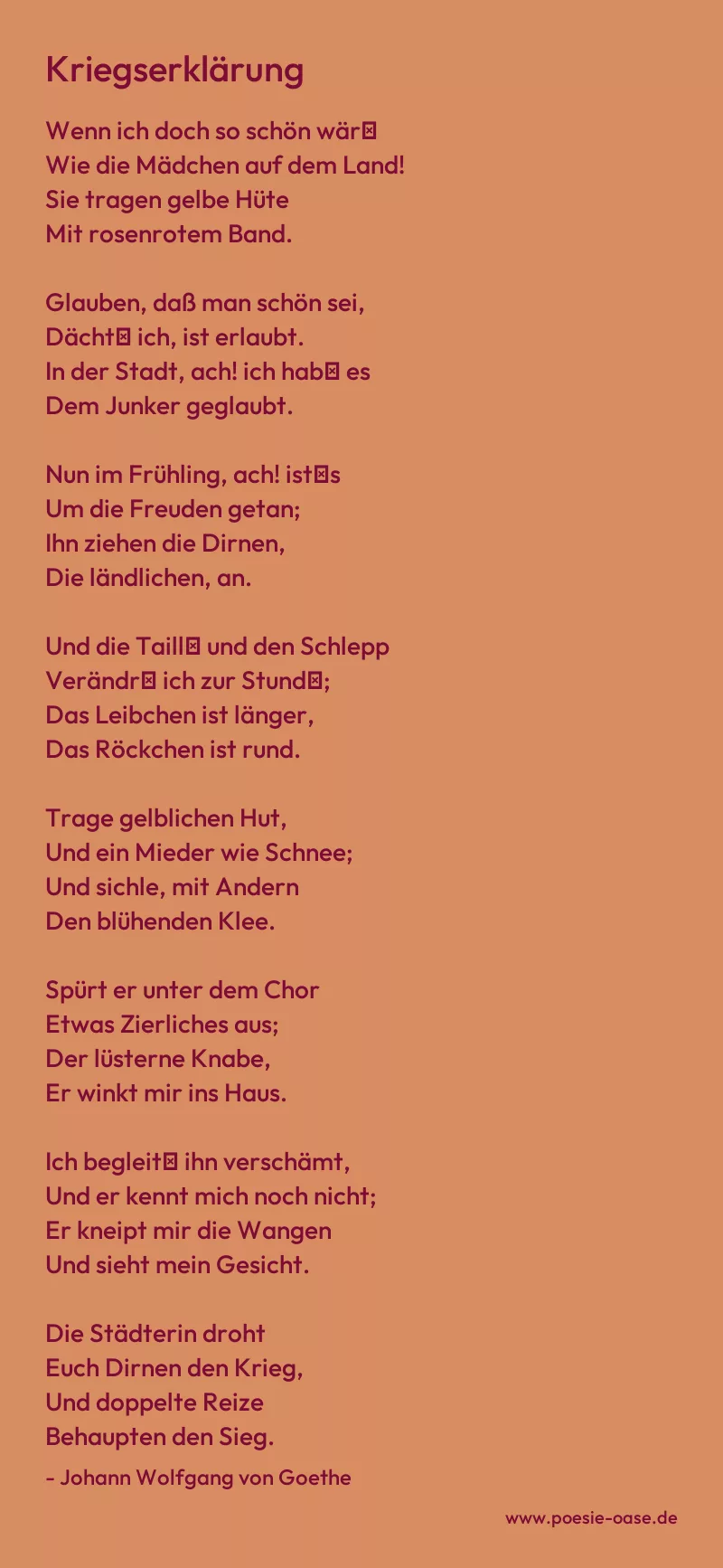
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Kriegserklärung“ von Johann Wolfgang von Goethe präsentiert eine ironische und selbstbewusste Auseinandersetzung einer jungen Frau mit dem Konkurrenzkampf um die Gunst eines Mannes, in diesem Fall eines „Junkers“. Das Gedicht ist in einem volkstümlichen Stil verfasst, der durch einfache Sprache, Reimschema und die Erwähnung von Alltagsgegenständen wie Hüten, Miedern und Röcken charakterisiert wird. Dies unterstützt die scheinbar naive Perspektive der Städterin, die sich der Regeln des Spiels bewusst wird und entsprechend handelt.
Die erste Strophe etabliert den Wunsch nach Schönheit und Einfachheit, die durch die Idylle der Landmädchen repräsentiert wird. Der Kontrast zwischen Stadt und Land wird hier deutlich, wobei die Stadt zunächst als Ort der Täuschung und des Verlusts von Illusionen erscheint. Der Junker, der das Interesse der Protagonistin geweckt hat, erweist sich als flüchtig und wendet sich im Frühling den „Dirnen“ vom Land zu. Dies markiert den Wendepunkt im Gedicht und löst die „Kriegserklärung“ der Städterin aus. Sie erkennt, dass sie ihre äußere Erscheinung und ihr Verhalten ändern muss, um mit den ländlichen Rivalinnen konkurrieren zu können.
Die folgenden Strophen beschreiben die Metamorphose der Städterin. Sie passt sich der ländlichen Mode an, indem sie einen „gelblichen Hut“ und ein „Mieder wie Schnee“ trägt. Sie simuliert Unschuld und Begeisterung, indem sie sich scheinbar unbefangen mit den anderen Mädchen im Feld vergnügt. Diese Verstellung gelingt, denn der Junker, der von der veränderten Erscheinung beeindruckt ist, zeigt erneut Interesse. Die Ironie liegt darin, dass die Städterin sich der Täuschung bedient, um ihr Ziel zu erreichen. Die letzte Strophe offenbart die „Kriegserklärung“, die sich in der bewussten Anwendung „doppelter Reize“ manifestiert.
Goethes Gedicht ist mehr als nur ein amüsantes Porträt eines Liebeskampfes. Es ist eine subtile Kritik an den gesellschaftlichen Konventionen und der Oberflächlichkeit, die oft in Beziehungen eine Rolle spielen. Die Städterin, zunächst naiv und enttäuscht, wandelt sich zu einer selbstbewussten Akteurin, die die Regeln des Spiels versteht und sie zu ihrem Vorteil nutzt. Das Gedicht endet mit einem vielschichtigen Gefühl, das von Ironie über Stolz bis hin zu einer gewissen Melancholie reicht. Es zeigt die Komplexität menschlicher Beziehungen und die Fähigkeit, sich an veränderte Umstände anzupassen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.