Sonst hielt man Wort nach deutscher Art,
Und schwur bey seinem Bart;
Allein seit langen Zeiten her,
Da trägt man keine Bärte mehr.

Tiefernst!
- Frieden
- Gemeinfrei
- Glaube & Spiritualität
Sonst hielt man Wort nach deutscher Art,
Und schwur bey seinem Bart;
Allein seit langen Zeiten her,
Da trägt man keine Bärte mehr.
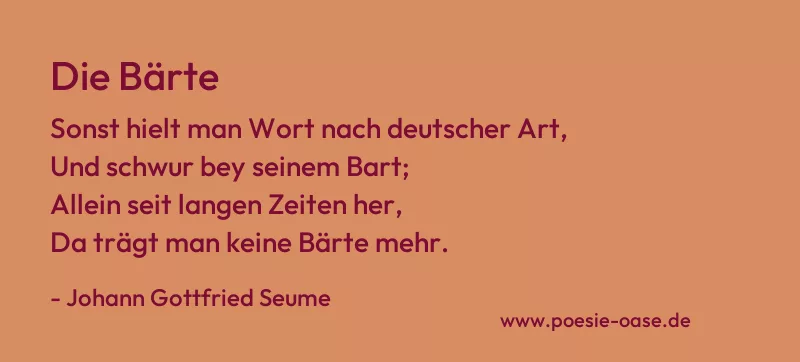
Das Gedicht „Die Bärte“ von Johann Gottfried Seume ist eine humorvolle und zugleich kritische Reflexion über den Wandel von Traditionen und gesellschaftlichen Normen. In der ersten Zeile wird eine alte deutsche Tradition angesprochen, bei der das Wort eines Mannes durch den Schwur „bei seinem Bart“ bekräftigt wurde – ein Symbol für Ehre und Verlässlichkeit. Der Bart, als ein markantes und traditionelles männliches Symbol, steht hier für die Authentizität und Ernsthaftigkeit der Worte, die gesprochen wurden.
Die Wendung „Allein seit langen Zeiten her“ deutet auf eine Veränderung hin, die im Laufe der Zeit stattgefunden hat. Der Verlust des Barts wird als Zeichen des gesellschaftlichen Wandels dargestellt, bei dem die alten Werte und Bräuche nicht mehr so wichtig sind oder nicht mehr praktiziert werden. Der „Bart“ als Symbol für Ehrlichkeit und Verlässlichkeit scheint in der modernen Zeit an Bedeutung verloren zu haben, was auf eine Veränderung in den sozialen Strukturen und Einstellungen hinweist.
Seume bringt hier auf humorvolle Weise zum Ausdruck, dass mit dem Verlust des Barts auch ein Stück Tradition verloren gegangen ist. Das Gedicht ist eine ironische Anmerkung zu den Veränderungen in der Gesellschaft und zu der Frage, inwieweit alte Werte und Bräuche weiterhin Bestand haben oder von der modernen Welt verdrängt werden. Seume lädt den Leser ein, über die Bedeutung von Traditionen und den Wandel von Symbolen nachzudenken, die einst als unerschütterlich galten.
Insgesamt ist das Gedicht ein kritischer, aber zugleich humorvoller Blick auf den Verlust von Traditionen und die Veränderung gesellschaftlicher Normen, wobei der Bart als leicht übertriebene Metapher für alte Werte und Wahrhaftigkeit dient.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.